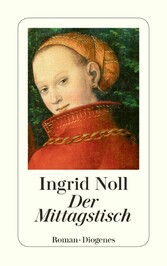Suchen und Finden
Service
Der Mittagstisch
Ingrid Noll
Verlag Diogenes, 2015
ISBN 9783257606966 , 224 Seiten
2. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[9] 1
Der Mittagstisch
Es war wahrscheinlich in Kassel oder Stuttgart, aber ich kann mich nur an eine gigantische Treppe erinnern, ähnlich der berühmten Freitreppe von Odessa. Vielleicht war auch alles ganz anders, denn ich war erst drei Jahre alt, vielleicht gibt es solche Treppen in keiner einzigen deutschen Stadt – ich muss demnächst meine Mutter fragen. Sie hielt mich damals fest an der Hand. »Nicht loslassen, Nelly!«, sagte sie. Ich gab diesen Befehl an meine Puppe weiter.
Wir hatten eine uralte Tante besucht, die nicht mehr lange leben würde. Meine Mutter wurde mit einem handgeschriebenen Testament und einer Granatbrosche beschenkt, ich mit einer Puppe. Sie fühlte sich anders an als meine weichgestopften Vinylbabys, denn sie war aus sprödem Zelluloid. Die Tante hatte selbst mit dieser Puppe gespielt und sie bestimmt achtzig Jahre lang auf ihrem Plüschsofa sitzen gehabt. Ich verstand durchaus, dass es sich um etwas Besonderes handelte, denn die Tante behauptete ebenso stolz wie geheimnisvoll, es sei eine echte Schildkröt.
Aus irgendeinem Grund hatte meine neue Puppe keine Lust, von meinem schmuddeligen Händchen umklammert zu werden. Auf der obersten Treppenstufe riss sie sich plötzlich los und stürzte in die Tiefe. Sie überschlug sich mehrmals, bis der Kopf sich löste, zerbarst und die einzelnen Teile [10] mit immer größerer Geschwindigkeit abwärtssprangen; nur ein Stück Rumpf blieb einige Stufen unter mir liegen. Ich schrie wie am Spieß. Immer wieder träume ich, dass meine kleine Tochter mir ebenso entgleitet, eine unendlich tiefe Treppe hinunterkullert und dabei ihren Kopf verliert. Vielleicht bin ich ja auch nur eine besonders ängstliche Mutter. Als Alleinerziehende ist man schnell überfordert.
Mein Freund Matthew war ein cooler Hund, wie eine Freundin anerkennend feststellte. Als er ein paar Jahre nach Carolines Geburt plötzlich zurück in die USA flog, versprach er zwar nicht, uns bald nachzuholen, aber selbstverständlich rechnete ich mit materieller Unterstützung. Seitdem war er unauffindbar, die hinterlassene Adresse stimmte nicht. Nach einigen frustrierenden Versuchen hatte ich es aufgegeben, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Mein Großer erinnerte sich noch ganz gut an seinen Vater und erwähnte ihn gelegentlich, meine Kleine tat das nie und fragte nicht.
Für einen Amerikaner sprach Matthew einigermaßen gut Deutsch, schließlich hatte er es von klein auf bei seinen Großeltern gehört. Da mein Englisch ziemlich dürftig ist, verständigte er sich mit mir und den Kindern fast nie in seiner Muttersprache und machte sogar gute Fortschritte im hiesigen Dialekt. In einer Hinsicht konnte er es allerdings zu keiner Perfektion bringen, und das waren die Artikel. Er ersetzte sie durch ein neutrales de: de Mann, de Frau, de Kind.
Um unsere Kinder von Anfang an auf die weite Welt vorzubereiten, wählten wir Vornamen, die auch in anderen Ländern bekannt sind: Simon und Caroline. Der Junge lernte [11] in der Grundschule bereits ein wenig Englisch, aber eher Lieder wie Jingle Bells und Happy Birthday; es war schade, dass die Geschwister nicht zweisprachig aufwachsen konnten. Matthew brachte ihnen vor allem Späße bei. An lustige Begebenheiten in unserer kleinen Familie dachte ich zuweilen wehmütig zurück, aber ich versuchte, mich mit meinem Status als alleinstehende Mutter ein für alle Mal abzufinden.
Einmal sagte er zum Beispiel zu unserem Sohn: »Es gibt de deutsche Sprichwort: Man soll nie de Sand in de Kopp stecke!« Das leuchtete Simon ein: Wenn er aus dem Kindergarten kam, rieselte es stets aus Haaren, Ohren, Schuhen und Kleidern. Dann drohte ihm Matthew mit dem Zeigefinger und scherzte: »Ick mack dir fünf Löcher in de Gesicht und steck’ dir de Kopp zwische de Ohre, Mister Sandman!«
Mein Sohn begriff solche Späßchen erst Jahre später. Doch vom großen Bruder eines Kindergartenkumpels lernte er einen kleinen Schabernack, den Matthew noch nicht kannte: Zweiunddreißig-heb-auf. Er schmetterte dem lernbegierigen Papa einen Satz Spielkarten vor die Füße und befahl: »Heb auf!« Dann weidete er sich am offenstehenden Mund und der verdatterten Miene seines Vaters. Als der Junge in die Schule kam, war es vorbei mit fröhlichen Neckereien, denn sein Vater verschwand plötzlich auf Nimmerwiedersehen.
Früher waren wir finanziell ganz gut zurechtgekommen. Matthew hatte stets ein paar Scheine in der Hosentasche, wir bekamen Kindergeld, und auch meine Mutter steckte uns immer wieder etwas zu. Doch als der Kindsvater [12] plötzlich spurlos verschwand, musste ich schleunigst eine bezahlte Arbeitsstelle finden. Leider konnte ich keine abgeschlossene Ausbildung vorweisen. Bereits nach wenigen Semestern hatte ich zum Leidwesen meiner Mutter mein Studium unter- und schließlich abgebrochen, weil ich keine rechte Lust mehr hatte und lieber als Barista hinter der Theke stand. Ich musste die Kaffeemaschine bedienen, warme und kalte Getränke zubereiten, kassieren und vor allem das hausgemachte Eis servieren. Dabei lernte ich täglich nette junge Leute kennen, schließlich auch Matthew. Schon nach kurzer Zeit wurde ich schwanger – ungeplant, aber nicht unwillkommen. Im siebten Monat beendete ich meine gastronomische Karriere und freute mich auf meine künftige Aufgabe als Mutter. Heiraten hielten wir für eine Spießererfindung, doch wir zogen zusammen und waren eine Zeitlang glücklich; auch als Caroline geboren wurde, herrschte noch tiefer Frieden. Auf den Anlass unserer Trennung möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, aber es hatte mit dem schrecklichen Kameruner zu tun. Plötzlich stand ich mit zwei kleinen Kindern allein da und musste sehen, wie ich zurechtkam.
Zum Glück erbte ich das Haus meiner Großeltern, dessen Erdgeschoss früher als Schreibwarenladen genutzt worden war. Kurz entschlossen verließ ich Frankfurt und zog mit den Kindern in meine Heimat an die Bergstraße zurück. Leider ließen sich die ehemaligen Geschäftsräume wegen der großen Schaufenster nicht so leicht als Wohnräume vermieten und blieben vorläufig ungenutzt, im oberen Stock lagen die gute Stube, Küche, Ess- und drei Schlafzimmer meiner Vorfahren. Seit meine Oma, die Mutter meines [13] frühverstorbenen Vaters, nach einem Unfall ins Altersheim hatte ziehen müssen und dort nach zwei Jahren verstarb, stand das Haus leer, eine leichte Verwahrlosung hatte bereits eingesetzt. Die Großeltern hatten durch die günstige Lage – direkt neben einer Schule – ihren Unterhalt mit dem Verkauf von Heften, Malsachen und Bleistiften bestritten. Doch als in der Nähe ein Supermarkt eröffnete, trieb sich die jugendliche Kundschaft lieber dort herum, und das Lädchen musste schließen.
Eines schönen Tages traf ich direkt vor meiner Haustür eine ehemalige Klassenkameradin, die Lehrerin geworden war. Wir freuten uns beide über das Wiedersehen, denn wir hatten uns nach dem Abitur aus den Augen verloren. Natürlich hatten wir uns viel zu erzählen, aber das Beste war, dass mein Haus nur wenige Schritte von der Schule entfernt lag. Regine versprach, oft und auch mal in der großen Pause vorbeizuschauen. Bald darauf schneite sie zur Mittagszeit herein und machte glückliche Augen, als wir uns an den Küchentisch setzten und ich den Nudelauflauf aus dem Backofen und einen vierten Teller holte. Die Kinder lauschten verwundert, da Regine eine sehr spezielle Ausdrucksweise hatte.
»Jetzt bin ich erst seit drei Monaten hier«, klagte sie, »aber ich kann mich überhaupt nicht an das zwar wohlfeile, aber lieblose Cateringessen in der Mensa gewöhnen, und mein hastig geschmiertes Butterbrot nehme ich oft wieder mit nach Hause. Im Dönerladen lungert meistens meine halbe Klasse herum, da halte ich mich lieber fern.«
Dreimal pro Woche musste Regine über Mittag bleiben, weil sie bereits um vierzehn Uhr wieder Unterricht hatte. Sie fand meine Idee unwiderstehlich, an diesen Tagen – [14] natürlich gegen angemessene Bezahlung – regelmäßig bei uns zu essen. Auch mir machte es Spaß, nicht immer nur Spaghetti oder Fischstäbchen zuzubereiten. Regine war zwar nett, aber manchmal kehrte sie allzu sehr die Lehrerin heraus. Es schadete meinen Kindern natürlich nicht, wenn sie gelegentlich kritisiert wurden. Doch leider hatte meine Freundin die Marotte, seltene, fast ganz aus der Mode gekommene Wörter zu benutzen. Sie fand es wohl lustig, trefflich statt gut, garstig statt schlechtgelaunt oder wohlfeil statt billig zu sagen. Was Wunder, dass meine Kinder schnell den einen oder anderen Ausdruck aufschnappten. Sie beschuldigten sich gegenseitig, Maulaffen feilzuhalten, ein Wildfang, Schelm oder Lümmel zu sein. Meine kleine Caro, wie Caroline genannt wurde, malte sogar die Sonne nicht an den Himmel, sondern ans Firmament und bezeichnete unsere Welt als Erdenrund.
Mit leichtem Vorwurf in der Stimme sagte ich zu Regine, dass mit dieser Marotte Schluss sein müsse.
»Mein Gott«, sagte sie. »Du bist aber bärbeißig! Wenn ich mit törichten Backfischen und pubertierenden Rotzlöffeln den Schimmelreiter durchnehme, dann verstehen die oft nur Bahnhof. Deine Kleinen sind später einmal im Vorteil.«
»Oder sie machen sich lächerlich«, sagte ich. »Ich frage mich immer wieder, wozu das gut sein soll!«
»Jahrelang wollte ich über den sprachlichen Wandel vom 19. ins 20. Jahrhundert eine Doktorarbeit...