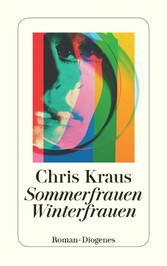Suchen und Finden
Service
Sommerfrauen, Winterfrauen
Chris Kraus
Verlag Diogenes, 2018
ISBN 9783257609165 , 416 Seiten
2. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
{21}1. Tag
Dienstag, 17.9.1996, 16 Uhr, London Heathrow
Mein rotes Hemd flattert unregelmäßig. Vom Herzen geschüttelt. Die Ohren brennen lichterloh. Ich bin auf dem Flughafen London Heathrow und warte auf den Anschlussflug.
Endlich nach New York.
17. September. Vier Uhr.
Heiß.
Ich hasse Fliegenmüssen.
Gestern, während des Abschlusstreffens.
Ich fand in Lilas Wohnung ein Fax nach Amiland. Er schrieb jemandem, den er »darling« nannte, dass er sich fühle »like three pink rats running through«. Das trifft es. Wenn Lila nervös ist, hat man das Gefühl, seine Lücke zwischen den Schneidezähnen werde größer, wie ein Kanonenschlitz. Sein schöner Humor verschwindet dann auf ganz ähnliche Weise wie bei mir hinter penibler Schulmeisterei, die subtil sein will. Aber subtil ist gar nichts an ihm. Er ist ein typischer Schütze, würde Mah sagen. Besteht ganz aus Triebkraft, die er in Idealismus umdekoriert.
{22}Der ganze Tag gestern war ein einziges Chaos. Sinnstiftung durch eine neue, billige Schwarzhose, ein schlafanzugartiges Sweatshirt mit blau-gelben Längsstreifen, in dem ich aussehe wie ein Verurteilter, und eine sehr schicke dunkle Jacke, die praktisch gar nichts kostete.
Ich kaufte alles beim Lieblings-Karstadt, innerhalb von zwanzig Minuten, wie ein Scheich. Einen Anzug konnte ich mir natürlich nicht leisten.
Lila hat mir eines seiner schwulen Jacketts geliehen, eine Art napoleonischen Militärrock, elfenbeinweiß, mit doppelter Knopfleiste. Man denkt an Kavallerieattacken bei Austerlitz.
Ich soll schön aussehen.
In mein Portemonnaie habe ich ein paar Kondome gepackt, eher mechanisch. Mah stand neben mir und hat gelacht, aber nicht vor Freude.
»Du guckst drauf, als wär’s Munition«, sagte sie.
Dabei weiß sie, dass sie sich keine Sorgen machen muss.
Sie macht sich aber trotzdem ein paar Sorgen. Um die Liebe und auch um mich. Wir sind jetzt seit drei Jahren zusammen. Seit über drei Jahren. Wir sehen keine Risse, fangen aber an zu lauschen. Hin und wieder knackt da was.
Gestern beim Sex hielt sie mir die ganze Zeit die Hände fest. Ich fragte, ob sie weint. Aber es war nichts.
Ich glaube, Europäer und Asiaten gehen mit ihren Gesichtsausdrücken völlig unterschiedlich um. Mahs Stirnfalte zum Beispiel. Wieso tritt die nicht wie bei mir hervor, wenn es Grund zum Ärgern gibt? Sondern immer nur vorm Orgasmus? Die fundamentalen Emotionen – Freude, {23}Überraschung, Angst, Wut, ja, sogar Trauer – kann Mah jedenfalls mit dem ewig gleichen, melancholischen Lächeln ausdrücken, das ihr angeboren zu sein scheint. Sie sagt, das kenne sie von Vietnamesinnen auch nicht anders. Was man mit dem Mund macht, oder mit der Stirn, bleibt in Vietnam ohne Wirkung. Wichtig sind nur die Augen. Es gibt nichts anderes, um aus dem Gegenüber schlau zu werden, und Mah versucht immer, in meinen Augen zu lesen. Mein Mund ist ihr egal.
Vorhin in Tegel schüttelten wir uns. Sie küsst jetzt viel weicher als am Anfang (also ganz egal ist ihr mein Mund auch wieder nicht). Seit Michis Tod ist sie mein einziger wirklicher Freund und meine halbe Familie.
Sie hat mir das Leben gerettet.
Jetzt warte ich hier in London im Terminal 4. Gerade geht eine Alarmanlage los. Ein schriller Sirenenton, kilometerweit zu hören. Ich schaue in das Gesicht eines vollendet gelassenen Inders neben mir, der sein Ticket studiert. Die Engländer (selbst die indischen Engländer) haben alle diese Ich-mache-mir-aus-Prinzip-keine-Sorgen-Gesichter.
Ist eine Maschine explodiert? Ein Feuer ausgebrochen?
Jetzt geht es schon vier Minuten.
Ich muss in den Flieger.
Am meisten hasse ich das Einsteigen. Es ist wie Abstürzen, ein unabdingbarer Teil davon.
{24}19 Uhr, Airbus 340
Ganz hinten im Flugzeug sitze ich, sitze leicht schwitzend in einem Sessel, der zurückzuschwitzen scheint. Das Essen, das sie einem bringen, riecht nach schlechtem Atem. Es schmeckt auch so. Die Birne-aus-Porzellan, wie Mah meinen Kopf nennt, liegt, wie es sich gehört, in der Mitte der Sessellehne. Sie bewegt sich wenig. Ich muss immer schön aufpassen, dass da niemand draufhaut. Als Kind habe ich mich oft geschlagen. Jetzt könnte mich diese Vierjährige da vorne umbringen, indem sie einfach auf den Sprung haut in meiner Schüssel. Und 10000 Meter über dem Meer tun dem kaputten Schädel auch nicht gut.
Ich sitze in der vorletzten Reihe. Alle fünf Minuten kommt der Steward, bittet einen aufzustehen, kniet sich zu Boden, kriecht unter den Sitz und fängt dort an zu arbeiten. Er ist so geschmeidig wie ein abgebranntes Streichholz und versucht, die Kabel für den TV-Empfang zu reparieren. Sein Rücken könnte zu Asche zerbröseln, sobald jemand draufklopft. Wenn der Fernseher nicht anspringt, wird es eine Meuterei unter den Passagieren geben.
Neben mir ein netter, unglaublich gutaussehender Fotograf, dreißig Jahre alt, ein Robert-Redford-Klon. Ist tatsächlich blond. Hat tatsächlich Charme. Heißt tatsächlich Robert. Robert Polanski. Er bestellt mit rollendem bayerischem Akzent »coffee please«.
Ich habe diese Mutfurcht, die mich vorantreibt, gebe mir ein gelassenes Gebaren und beginne das Gespräch, indem ich ihn auf die Robert-Redford-Ähnlichkeit anspreche.
{25}Er hat es schon öfter gehört. Noch öfter als die Roman-Polanski-Ähnlichkeit des Namens und die unentrinnbare Frage, ob er Jude sei wie dieser berühmte Regisseur.
Ich mag ihn. Er liebt den Film Sundance Kid.
Wir reden, um uns abzutasten, über die Statistiken von Toilettennutzung auf Transatlantikflügen. Neben uns staut sich eine Menschenschlange. Die Leute setzen sich uns fast auf den Schoß vor Ungeduld.
Statistik 1: Jeder zwanzigste männliche Flugzeugpassagier mit gefüllter Harnblase uriniert in die Waschschüssel statt in die Toilette. Behauptet Redford.
Statistik 2: Nur Frauen REDEN beim Warten auf die Toilettenschüssel. Männer hingegen SCHWEIGEN grimmig, selbst wenn man ihnen, so wie Redford eben, aus Versehen heißen Kaffee auf die Hose schüttet.
Statistik 3: Je länger die Schlange ist, desto länger wird sie. Ist aber gar keine Statistik.
Interessant an Redford ist, dass er sofort im Verhalten der Menschen, selbst wenn es weder paradox noch sonstwie auffällig ist, nach einer psychologischen Erklärung sucht. Das macht sicher sein Job als Fotograf. Er behauptet, schon nach drei Sekunden in einem Gesicht lesen zu können, wie tot der Mensch ist, dem es gehört.
Als Redford erfährt, dass ich Filmstudent bin und vier Wochen in New York bleiben werde, ist er ganz begeistert. Er kann es nicht glauben, als ich ihm von dem Projekt erzähle.
»Du machst einen Sexfilm?«, fragt er.
»Nein. Keinen Sexfilm. Einen Film über Sex.«
{26}»Und was wird man sehen?«
»Ich muss noch überlegen.«
»Ich meine, so in etwa.«
»Wirklich, ich muss noch überlegen.«
»Wird man zum Beispiel eine Möse sehen?«
Ich erzähle ihm von Lila.
»Lila von Dornbusch?«
Er setzt gleich dieses wissende Lächeln auf. Der prominente Name ist wie ein Knopfdruck ins kollektive Unterbewusste. Er kann nicht glauben, was ich ihm sage. Es klingt zu verrückt. Ein Dokumentarfilm über Sex. Ohne Drehbuch, ohne Konzept, ohne Geld und ohne Möse, wenn es sein muss.
Vor ein paar Tagen noch saßen wir alle bei Lila in der Regensburger, umstellt von seinen mit allerlei tropischem Getier gefüllten Terrarien. Wir hatten eine dieser typischen Krisensitzungen, die vor allem der sensiblen Python immer zu laut sind.
Das Wohnzimmer wird vom Regieruhm illuminiert, der von Lilas siebziger und achtziger Jahren noch nachglüht: Überall Preisskulpturen, Pastellgemälde, Plakate mit Filmstars wie Hildegard Knef drauf. Ein Schwarz-Weiß-Foto von Charles Bronson, der sich einen riesigen erigierten Penis in den Mund schiebt. Und ein goldener Thron aus Plastiktitten, der neben dem Anakondaterrarium steht und irgendein Relikt der Trashfilme ist, mit denen Lila von Dornbusch Jahr für Jahr ein immer winzigeres Publikum belästigt.
Seit zwei Jahren ist er Professor an der Berliner {27}Filmakademie. Er braucht das Geld. Als Kind war er verträumt und nachlässig, blieb viermal sitzen und hat keinen Schulabschluss. Nicht mal Bäckerlehrling hätte er werden können.
Ein Professor braucht keinen Schulabschluss, sagt er, nur ein Student. Er findet es auch wichtig.
Eigentlich hat sich durch das Seminar nicht wirklich was verändert. Vielleicht eine andere Art der Fremdheit zwischen uns allen, aber keine schönere.
Dabei haben wir uns alle entblößt voreinander, seelisch, körperlich.
Sechs Monate Intensivstation. Und dann Reset.
Rücksturz zur Erde.
Es stellt sich schließlich nur der Teil des Familiären ein, der einem an jeder Familie auf den Keks geht.
Dabei fing alles so revolutionär an. Also was man eben revolutionär finden kann an einer Hochschule. Das vermutlich abstruseste Seminar, das die Filmakademie je gesehen hat. Ich war ganz elektrisiert, als mich im offiziellen Vorlesungsverzeichnis ein Kursangebot angrinste, das ausnahmsweise mal nicht »Somatische Empathie bei...