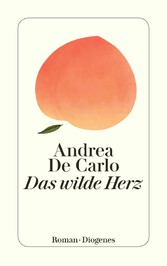Suchen und Finden
Service
Das wilde Herz
Andrea De Carlo
Verlag Diogenes, 2019
ISBN 9783257609431 , 464 Seiten
2. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
Eins
Als Craig Nolan im Januar 2015 am Schreibtisch seines Arbeitszimmers in der Little St Mary’s Lane in Cambridge an seine erste Ankunft mit Mara in Canciale zurückdenkt, während die Stereoanlange leise Jumping At Shadows von Peter Green spielt und vor den Fenstern am schon beinah dunklen Nachmittag der Regen fällt, schwankt er bei der Erinnerung ständig zwischen Sehnsucht, Fassungslosigkeit und Verärgerung.
Die zu beantwortende Frage ist immer die gleiche: War es unvermeidlich, dass es so weit kommen musste? Hätte er den Lauf der Ereignisse, die zur jetzigen Situation geführt haben, aufhalten oder zumindest in eine weniger katastrophale Richtung lenken können? Ja, bestimmt, und nein, bestimmt nicht, wie bei allem, was geschieht. Genau genommen hätte er dann gar nicht erst in den alten blauen Bus steigen dürfen, der unverdrossen die kurvige Straße in die immer steiler werdenden Berge hinaufächzte, viel weiter von der Küste weg, als er sich vorgestellt hatte. Er hätte auf seine innere Stimme hören können, die ihm riet, eine vorübergehende sinnliche Anziehung nicht mit einer langfristigen emotionalen und praktischen Verbindung zu verwechseln. Es hätte genügt, eine plötzlich unvermeidliche Arbeitsverpflichtung vorzuschützen, einen Notfall an der Universität, irgendeinen fachlichen Grund, weshalb seine Anwesenheit in der Mongolei oder auf den Salomon-Inseln dringend geboten war. Oder er hätte mit brutaler Offenheit erklären können, dass er sich für eine dauerhafte Beziehung nicht bereit fühle, auch nicht mit einer so interessanten Frau wie ihr; oder darauf pochen, dass seine Tätigkeit und sein unkonventionelles Denken nicht mit einem Lebensstil nach den Standards der sogenannten Reife vereinbar seien. Zumal Mara selbst so stolz war auf ihre Unabhängigkeit, so agil und ruhelos: Alles, was sie zum Zeitpunkt ihrer Begegnung begehrte und praktizierte, war das Gegenteil von Langeweile und Wiederholung. Sie war die freieste, selbständigste Frau, die er je kennengelernt hatte, eine begabte junge Bildhauerin, die gerade mühsam eine lange, schwierige Beziehung zu einem bipolaren Geigenbauer beendet hatte und nicht im Entferntesten daran dachte, von einem Mann Beteuerungen oder Garantien für die Zukunft zu verlangen! Und ihre Beziehung stand ja noch ganz am Anfang, war noch ganz ohne gemeinsame Gewohnheiten, gemeinsame Ausdrucksweisen, Pläne oder andere stabilisierende Elemente. Warum war er bloß in diesen Bus gestiegen, wenn er die möglichen Folgen der kaum einstündigen Fahrt doch schon geahnt hatte? Warum konnte er sich der gegenseitigen Faszination, dem Bröckeln des Widerstands, dem gefährlichen Sich-Aussetzen und dem Leichtsinn, der sicheren Schaden anrichtet, nicht entziehen? Einfach weil ihm schien, im Namen seiner Unabhängigkeit auf die momentane Aufregung zu verzichten sei eine Geste unerträglicher Feigheit, die er hinterher für immer bedauert hätte; es war ihm nicht gelungen, sich uninteressiert, antriebslos und gefühlsgeizig zu geben. Letztlich war das ein vorgezeichneter Weg: zu ahnen, wohin er ihn führen würde, hatte ihn nicht daran gehindert, ihm Schritt für Schritt zu folgen.
Als sie endlich in Canciale ankamen, ihre Rucksäcke abstellten und sich umsahen, sprach sein Selbsterhaltungstrieb immer noch eine unmissverständliche Sprache. Außer der Übelkeit wegen des vierzigminütigen Gerüttels und der Enttäuschung, die proportional zur Entfernung zum Meer gewachsen war, packte ihn, wenn auch nur nach und nach, das untrügliche Gefühl, dass er dabei war, einen großen, nicht wiedergutzumachenden Fehler zu begehen. Doch verschwand dieses Unbehagen schlagartig, sobald Mara ihn mit dem gleichen Lächeln ansah wie vier Tage zuvor in Mailand, als sie ihm, während er durch die Stadt spaziert war, weil er auf einen Interviewtermin wartete, auf der Piazza Cordusio zufällig begegnet war. Diese Italienerin mit dem Lockenkopf, den kastanienbraunen Augen und den kräftigen, aber zugleich weichen Formen hatte ihn so beeindruckt, dass er sie (in einem damals noch sehr vagen Italienisch und mit einem Übermut, über den er selbst erstaunt war) gefragt hatte: »Perdono, dove è la piazza del Duomo?«, obwohl er genau gewusst hatte, dass der Domplatz keine hundert Meter hinter ihm lag. Daraufhin hatte sie ihn halb amüsiert, halb neugierig gemustert und ihm unerwartet auf Englisch geantwortet: »Seriously?« Und danach hatten sich ihre Lippen zu dem strahlendsten Lächeln geöffnet, das er je gesehen hatte, und mit einem Mal war das gesamte achttägige Programm anlässlich des Erscheinens der italienischen Ausgabe von Das wilde Herz über den Haufen geworfen. Plaudernd waren sie die Via Orefici entlanggegangen, und er hatte sie zu einem Aperitif in der Galleria überredet (sie bestellte einen Americano, er einen Martini). Ihr Gespräch war so anregend, dass er sein Interview im Hotel komplett vergaß und sie zu seinem Vortrag am folgenden Abend einlud. Nach dem Vortrag ließen sie kurzerhand das offizielle Abendessen sausen, suchten sich ein kleines Restaurant, wo sie niemand störte, und waren von da an unzertrennlich. Er sagte alle seine Termine in Florenz, Pisa und Rom ab, und sie verbrachte wesentlich weniger Zeit mit ihren Eltern, als sie sich eigentlich vorgenommen hatte; drei Tage erkundeten sie gemeinsam die Stadt, drei Nächte die Suite des Hotels, die der Verlag für ihn gebucht hatte; am vierten Tag fuhren sie mit dem Taxi zur Stazione Centrale und stiegen in einen Zug nach Ligurien.
Und nach der Busfahrt von der Küste in die Berge stand er also neben diesem wunderbaren südländischen Mädchen mit dem unruhigen Geist und den erstaunlichen künstlerischen Fähigkeiten, die ihn nun wieder auf ihre unwiderstehliche Art anlächelte und fragte, ob ihm die Reise gefallen habe. Er bejahte, ohne zu zögern: glücklich, ein neugieriger und anpassungsfähiger Reisegefährte zu sein, ein experimentierfreudiger Partner, ein international bekannter Akademiker, der sich jedoch nicht zu ernst nahm, ein Forscher, der sich unter den ehemaligen Kannibalen der Korowai ebenso wohl fühlte wie unter den Bewohnern einer italienischen Region, die zu den weniger fremdenfreundlichen zählt. Die Aufmerksamkeit und Bewunderung, die er in jedem Blick und jedem Wort von Mara wahrnahm, bei jedem Schulterstreifen, berauschte ihn wie eine Droge. Dass er bei einer Frau Aufmerksamkeit und Bewunderung weckte, erlebte er zwar nicht zum ersten Mal, doch bei ihr begeisterte es ihn, weil sie selbst so viel Aufmerksamkeit und Bewunderung verdiente. Ist das vielleicht der springende Punkt? Ist er tatsächlich dermaßen narzisstisch veranlagt, dass er sich von einer naturgemäß vergänglichen Euphorie blenden ließ und dadurch die möglichen Folgen für seine intellektuelle und materielle Unabhängigkeit völlig ignorierte?
Jedenfalls sind die Bilder und Empfindungen dieser ersten Ankunft in Canciale in seiner Erinnerung sehr viel klarer als die Gedanken, die ihm damals durch den Kopf gingen: Er braucht sie sich nur ins Gedächtnis zu rufen, schon sind sie lebendig und pulsierend wieder da. Die Gedanken dagegen sind trüb, lückenhaft, sie kommen nicht an gegen die Kraft der eindrucksvollen Bilder von Mara, die ihn aufgeregt, ungeduldig und doch vorsichtig die enge Straße hinunterführt. Sie geht erst rasch, dann verlangsamt sie ihren Schritt, dreht den Kopf in alle Richtungen, schnuppert in der Luft, nimmt tausend Einzelheiten wahr. Er folgt ihr, und sie weiß um seinen Blick, der auf ihr ruht, und bewegt sich dennoch völlig natürlich in ihrem leichten geblümten Baumwollkleid, das ihren Körper betont und die energischen, eleganten Beine entblößt, die starken, wohlgeformten Füße in den dünnen, von der Sonne gebleichten Ledersandalen. Und weiter: Er folgt ihr und fühlt, sein Gesicht ist zu rosa, sein Haar zu hell und zu schütter, seine Kopfhaut zu sichtbar, die Arme zu unbehaart und die Oberschenkel, Knie und Waden zu stämmig in der kurzen Khakihose mit den zu vielen Taschen. Und weiter: Zusammen gehen sie an den pastellfarben oder zementgrau verputzten Häusern vorbei, an den holzgezimmerten Hühnerställen mit den Wellblechdächern, den kleinen Gemüsebeeten in den Gärten, den Autos und den motorisierten Dreiradkarren am Straßenrand, dem Röhricht, den Müllcontainern und den Robiniensträuchern, um schließlich vor einem kleinen, zweistöckigen Gebäude von verblichenem Rot stehen zu bleiben. Und endlich: Erneut stellt Mara den Rucksack ab, deutet mit vor Rührung glänzenden Augen auf die Fassade, und ein leichtes Zittern überläuft ihre schön geschwungenen Lippen.
Doch klangen nicht auch in dieser begeisterten Wahrnehmung von Formen, Strukturen und Temperaturen schon Misstöne an? War er nicht bestürzt, wie wenig die Realität des Ortes mit den Vorstellungen übereinstimmte, die ihre vorigen Erzählungen genährt hatten, elektrisiert vom Wunsch nach mehr, durchzogen vom fieberhaften Informationsaustausch? Wo war der vielbeschworene Zauber von Canciale, diesem irdischen Paradies, überreich an köstlichen Früchten und bewohnt von einfachen, freigebigen Menschen? Wie viel von dem, was er vor Augen hatte, stimmte mit der automatischen Visualisierung überein, die auf den Erinnerungen an andere Mittelmeerorte basierte, ausgeschmückt durch Fotografien, Filmausschnitte, Werbung, Broschüren von Reisebüros und reine Phantasie?
Die Wahrheit (aber welche Wahrheit, die heutige oder die von damals?) ist, dass Canciale ihm unfreundlich, verwahrlost und irgendwie trostlos vorkam; wie die feuchte, weitläufige, ländliche Peripherie eines Dörfchens im Apenninvorland, das sich zwischen Licht und Schatten an die steilen Berghänge klammerte. In nichts glich es...