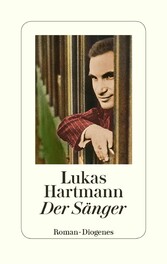Suchen und Finden
Service
Der Sänger
Lukas Hartmann
Verlag Diogenes, 2019
ISBN 9783257609486 , 288 Seiten
2. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
1
Gegen Ende September konnten im Süden die Abende, auch auf achthundertfünfzig Meter über Meer, noch angenehm warm sein. Darum hatte sich die Gruppe bis zum Dunkelwerden draußen im Garten unterhalten, ein wenig Schafkäse und Brot vom Vortag gegessen, sich gegenseitig vom Landwein eingeschenkt. Ein paar Flaschen waren schon leer. Aus einem Keller in der Nähe roch es nach Trester, der Duft der letzten Rosen lag in der Luft, irgendwo raschelte etwas im Herbstlaub. Eine Eidechse, dachte der Sänger. Er hatte zu den Fluchtrouten, die am Tisch erwogen wurden, kaum etwas gesagt, sein geographisches Vorstellungsvermögen war gering, er hatte sich bloß ab und zu geräuspert, er wusste ja, wie heiser seine Stimme inzwischen war, und schämte sich deswegen. In Clermont-Ferrand würden Helfer auf sie warten, anderswo auch, das Netz der Résistance war mittlerweile erprobt. Er wehrte die Mücken ab, die um seine Ohren sirrten, diesen Ton ertrug er schlecht, zudem brachte die Nacht einen kühleren Hauch auf die Haut.
»Du singst uns doch etwas zum Abschied, Jossele«, sagte Lucie, die Hausherrin. Sie bat die Gäste ins Innere des Hauses, in den Salon, wo das Klavier stand.
Schmidt spürte, wie abgekämpft er war, doch er folgte Lucies Wunsch und ging mit Mühe über die drei Steinstufen hinein, aber stützen ließ er sich nicht. Drinnen hatte Lucie, zusammen mit Selma, die ihn auf der Flucht begleiten würde, ein paar Kerzen angezündet, die Gäste hatten sich im Halbkreis gesetzt, um ihm ein letztes Mal zuzuhören. Lucie mit dem dunklen Lockenhaar, Selma die Sanftmütig-Helle, und doch hätten es Schwestern sein können. Er schraubte den Stuhl herunter, so dass seine Füße die Pedale erreichen konnten. Ob die Stimme ihm gehorchen würde, wusste er nicht, aber er wollte es versuchen, und schon lange war ihm klar gewesen, dass er als Letztes in der Villa Phoebus, die nun ein paar Wochen seine Zuflucht gewesen war, die Elegie von Massenet vortragen würde. Etwas Passenderes gab es nicht für diese Stunde. Er spielte, ohne in die Runde zu blicken, die Einleitung. Das Klavier war leicht verstimmt, das obere G zu hoch, das durfte ihn jetzt nicht stören. Die ersten Akkorde, dieser Abstieg in Halbtönen, erklangen, eigentlich hätte ein Cello sie spielen müssen, aber die Töne unter seinen Fingern klangen sanft, so wie es sein musste. Dann setzte er mit seiner Tenorstimme ein und staunte, wie gut sie trotz aller Beschwerden klang, wie die Trauer gleichsam durch sie schimmerte. Er sang die französische Version wie bei seinem letzten Konzert in Avignon, vor einem knappen halben Jahr, es war ihm untersagt gewesen, auf Deutsch zu singen.
Rêve d’un bonheur effacé,/mon cœur lassé/T’appelle en vain dans la nuit.
Geliebte hatte er, der Sänger, viele gehabt und sie immer wieder verlassen, wie er nun auch diesen Ort verlassen würde. Nicht um der Einen die Treue zu halten, der Mutter, die starrsinnig in Czernowitz bleiben wollte, sondern dieses Mal, um der Deportation zu entgehen und sein Leben zu retten. Die Deutschen waren unterwegs in Pétains Rumpf-Frankreich und durchsuchten es nach versteckten Juden, sie würden auch nach La Bourboule kommen.
La paix du soir vient adoucir nos douleurs,/Tout nous trahit, tout nous fuit sans retour, sang er. Tout nous trahit sans retour. Ohne Wiederkehr, das waren die letzten Worte, er ließ sie verschweben, die Klaviertöne verklingen. Es blieb lange still im Salon, draußen meldeten sich einzelne Vögel, als würden sie das Konzert auf ihre Weise fortsetzen. Er blieb sitzen, aufgewühlt und doch, wie fast immer, getröstet von der Musik, dann sagte Mary Solnik: »Wie wahr, wie traurig!« Sie war die dritte der Schönen, neben Lucie und Selma, er mochte, nein, er liebte jede auf ihre Weise; er hatte nie aufgehört, Schönheit zu lieben und um sie zu werben.
Erstickte Geräusche, jemand weinte in ein Taschentuch, vielleicht noch jemand Zweites. Wie oft hatte er sein Publikum zu Tränen gerührt, und wie oft hatte er es ausgekostet, mit seiner Stimme so viele Menschen zu bannen. Er war sicher, dass Caruso Massenets Elegie nicht besser gesungen hatte als er, Joseph Schmidt, aber Caruso, seit zwei Jahrzehnten tot, war kein Jude gewesen, und er wurde, wie Beniamino Gigli, der Mussolini bewunderte, nach wie vor in Nazideutschland verehrt. Er hingegen, der Sänger Joseph Schmidt, den man als den deutschen Caruso bejubelt hatte, war aus den Blättern und Radiosendern verschwunden, aus Filmen herausgeschnitten, die Schallplatten gab es nicht mehr in den Läden. Ein Verbot nach dem anderen hatte nach 1933 das Wirken der Juden im deutschen Musikleben eingeschränkt, schließlich unmöglich gemacht; wer konnte, war rechtzeitig geflüchtet. Und trotzdem galt vielen das Verstörende, das man jetzt über die Lager vernahm, immer noch als bloßes Gerücht. Nicht bei Schmidt. Er wusste, worum es ging: um die Ausrottung des Judentums in Europa. Den Nichtsahnenden konnte er nicht mehr spielen; zu viel hatte er in den letzten Monaten gehört. Auch die Hoffnung schwand, dass er seiner Mutter im Ghetto von Czernowitz aus der Ferne beistehen könnte.
Zaghafter Applaus setzte ein, er brachte ihn mit einer Handbewegung zum Verstummen. Es blieb still, abgesehen von vereinzelten Vogelrufen. Dann kam jemand unbeholfen die Treppe herunter, Guy, Lucies dreijähriger Sohn, für den die Stufen noch fast zu hoch waren.
»Mama«, sagte er, »ich will die Musik auch hören.«
»Sie ist zu Ende«, sagte Lucie, »aber du hast sie ja oben gehört, oder nicht?«
Das Kind wurde von der Mutter auf den Schoß gehoben, in die Arme geschlossen, und nun fingen einige der Gäste halblaut miteinander zu reden an. Mit Guy hatte Joseph in den letzten Tagen oft gescherzt, er hatte mit ihm gesungen, auch jiddische Lieder, obwohl Lucie das nicht mochte und noch weniger ihr Mann, der Textilunternehmer mit dem weichen Gesicht. Der Gast hatte Ringelreihen mit Guy getanzt, ihn im Takt an den Armen herumgeschwungen. Er mochte diesen Jungen mit dem Lockenkopf, der so unbändig lachen konnte, er erinnerte ihn entfernt an seinen jüngeren Bruder, der in der Bukowina geblieben war. Aber jetzt von Guy Abschied zu nehmen, brachte er nicht über sich. Der Kleine würde morgen gewiss nach Joschi fragen, und Lucie würde ihre Locken schütteln und ihm vorlügen, der Onkel sei abgereist und komme bestimmt bald wieder.
Schmidt stand auf, er fühlte sich körperlich besser als zuvor, aber es lag so viel Unbekanntes vor ihnen, den Fluchtwilligen, dass ihm von Minute zu Minute banger wurde.
»Wir müssen aufbrechen«, sagte er zu Lucies Mann, den er einst in Berlin kennengelernt hatte. Der nickte, ein bisschen zu nachdrücklich. Der Passeur, der Fluchthelfer, war inzwischen eingetroffen und stand bei der Tür im Schatten, ein junger Mann aus der Umgebung, Mitglied der Résistance, er war dunkel gekleidet, mit breitkrempigem Hut. Er würde sie zu Fuß in die Nähe von Clermont-Ferrand bringen; in einem Auto um diese Zeit aus dem kleinen Kurort wegzufahren, wäre zu auffällig gewesen. Wer genau ihre Route vorbereitet hatte, wusste Schmidt nicht, er wollte es auch nicht wissen. Falls die Deutschen ihn erwischen und im berüchtigten Gefängnis von Lyon foltern würden, konnte man ihm keinen Namen abpressen oder höchstens erfundene. Er hatte zu lange gezögert, das wusste er, er hatte die Mutter, die in Czernowitz ausharrte, nicht im Stich lassen wollen. Wer hätte sich vor wenigen Monaten vorstellen können, dass in Europa als mögliches Exil für Juden und Nazigegner bloß noch die Schweiz übrigbleiben würde? Er hatte eigentlich andere Pläne gehabt. Mit größter Mühe war er in Nizza, in der unbesetzten Zone, zu einem Visum für Kuba gekommen; und dann, am Vortag seiner vorgesehenen Abfahrt, hatten die Japaner Pearl Harbour überfallen. Kuba hatte an der Seite der USA den Achsenmächten den Krieg erklärt, und deshalb war nun der Schiffsverkehr ab den französischen Häfen lahmgelegt. Keine Möglichkeit mehr wegzukommen, die Restriktionen von Vichy-Frankreich verschärften sich, jeden zweiten Tag mussten sich die Flüchtlinge bei den Behörden melden. Man wies Schmidt als vorläufigen Aufenthalt den Kurort La Bourboule, in der Auvergne, zu. Lucie und Ernst, die dort noch vor dem Krieg ein Anwesen gekauft hatten, boten ihm Gastrecht an, das ersparte ihm das Internierungslager im Ort. Es waren von Nizza aus zehn Stunden bis dorthin gewesen, in vier verschiedenen Zügen. Schmidts Verzweiflung nahm auf dieser Fahrt zu, er konnte sie nicht mehr mit kleinen Späßen oder beim Singen überspielen, denn auch die Musik, die er als seine eigentliche Heimat ansah, hielt die Realität immer weniger von ihm ab.
Nun also die Schweiz, das hieß: fünfzig Kilometer bis Clermont-Ferrand, danach fast dreihundert bis Genf. Über die Grenze zu gelangen, auch das hatte man ihm gesagt, würde nicht einfach sein. Die Schweiz hatte in den letzten Monaten ihre Abwehrmaßnahmen gegen Flüchtlinge rigoros verstärkt, Juden, erkennbar meist am J im Pass, wurden seit August konsequent zurückgewiesen. Man könne bloß hoffen, dass alles gutgehen würde, hatte Mary gesagt. Sie und ihr Mann waren, der Kinder wegen, nicht bei der Flüchtlingsgruppe, sie hofften, sie würden mit gefälschten Pässen in einem Dorf in der Haute-Savoie der Gefangennahme entgehen. Aber Selma Wolkenheim kam mit, die auf die Hilfe ihres wohlhabenden Bruders, Zigarrenfabrikant in Zürich, setzte, dazu zwei Männer, Jakob und Arnold, die Joseph kaum kannte, Juden wie Selma und er. Erst seit drei Tagen waren sie in La Bourboule, fürchteten um ihr Leben und...