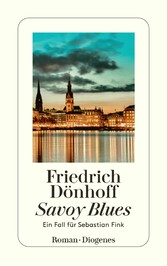Suchen und Finden
Service
Savoy Blues - Ein Fall für Sebastian Fink
Friedrich Dönhoff
Verlag Diogenes, 2012
ISBN 9783257600834 , 320 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[5] 1
Als er zum Himmel blickte, traf ihn ein Tropfen mitten ins Auge. Über der Stadt hing das Sommergewitter, und wenn er nicht pitschnass ankommen wollte, würde er sich beeilen müssen. Er klemmte die schwarze Tasche mit den Utensilien fest unter den Arm und lief los. Zwei, drei Straßen musste er bis zu seinem Ziel durchqueren, und er schien Glück zu haben, denn unterwegs begegnete er keinem einzigen Menschen. Es donnerte einmal gewaltig, der Wind schüttelte die Bäume in der Lindenallee. Gerade war er unter dem Vordach von Haus Nummer 78 angekommen, als hinter ihm der Regen in die Baumkronen rauschte. Er wartete eine Weile, bis er wieder zu Atem gekommen war, zupfte seine weiße Pflegerjacke zurecht und schaute auf die Klingelschilder. Karl Perkenson wohnte im zweiten Stock, das hatte er in Erfahrung gebracht, der Knopf befand sich im unteren Viertel der Leiste. Nachdem er sich kurz umgesehen hatte, klingelte er. Er bemerkte das Zittern in seinen Fingern, und das lag sicherlich nicht an irgendeiner äußeren Kälte. Im Gegenteil, vom Laufen war ihm warm, und die kalten Regenspritzer, die in sein Gesicht geweht waren, hatte er als wohltuend empfunden. Aber so nervös wie heute war er lange nicht mehr gewesen, vermutlich kam es ihm auch deshalb so vor, als wartete er schon ewig auf Einlass. [6] Perkenson war offensichtlich nicht mehr so gut auf den Beinen. Als der Summer dann endlich ertönte, schob er die Haustür mit Schwung auf. Aus dem Treppenhaus schlug ihm ein modriger Geruch entgegen. Dunkel war es hier. Und schmal. Das ist ein Treppenhaus, in dem man sich sofort unwohl fühlt, dachte er und wunderte sich zugleich, dass er solchen Gedanken Platz einräumte, wo seine ganze Konzentration doch der bevorstehenden Aufgabe gelten sollte. In den letzten Tagen war er sich vorgekommen wie ein Skispringer hoch oben auf der Startrampe. Hatte der sich einmal in Bewegung gesetzt, konnte er nicht wieder zurück. Es gab nur noch den Weg nach vorn, den Blick in die Weite und das Risiko, ob man unten lebend ankäme. Lange hatte er überlegt, ob er seinen feingesponnenen Plan wirklich durchziehen sollte, ob er das könnte, hatte sich nächtelang gewälzt, hatte gezögert, überlegt und wieder gezögert. Bis zu dem Moment, irgendwann tief in einer Nacht, in dem er sich zum Handeln entschieden hatte und sich schwor, nicht mehr umzukehren. Der Skispringer hatte sich abgestoßen, das Tempo erhöhte sich, er raste auf der Rampe bergab und musste alle Kraft und Konzentration aufbringen, um sich auf den Beinen zu halten. Und dann war er in der Luft, über ihm nur der Himmel, unter ihm nichts.
Als er die Stufen im schmalen Treppenhaus erklomm, spürte er seine weichen Knie. Kurz bevor er den zweiten Stock erreicht hatte, sah er dort oben in der Türöffnung einen Fuß in einem braunen, grobgestrickten Strumpf.
»Sozialstation«, sagte er zu Karl Perkenson.
Der Mann, der ihm gegenüberstand, war größer, als er ihn sich vorgestellt hatte, vielleicht eins fünfundachtzig, also ein [7] wenig größer noch als er selbst. Die ungekämmten grauen Haare waren ein merkwürdiger Kontrast zum gebügelten Hemd. Seine Augen wirkten müde.
»So früh?«, fragte Perkenson. Die Stimme klang blechern, aber nicht schwach.
»Ich bin die Aushilfe, wir mussten umdisponieren.«
Der alte Mann zuckte leicht die Schultern, murmelte was von »ist mir egal« und ließ ihn in die Wohnung. Er schien keinen Verdacht zu schöpfen.
Das Erste, was ihm beim Eintreten in Perkensons Wohnung auffiel, war die Dunkelheit. Im Treppenhaus dunkel, hier dunkel – er hasste Dunkelheit. Hatte Perkenson die Vorhänge zugezogen, oder war es draußen inzwischen so grau, dass man drinnen das Licht anschalten musste? Donnergroll erklang dumpf und unüberhörbar. Perkenson ging darauf nicht ein. Konnte gut sein, dass er schlecht hörte, schließlich war er über achtzig Jahre alt. »Komm, wir gehen in die Küche«, meinte der Alte und bewegte sich mit schweren Schritten, unter denen die Holzdielen knarrten, durch den engen Flur. Während er Karl Perkenson folgte, bemerkte er den Geruch von ungelüfteten Klamotten, der schwer in der Luft hing. In der kleinen, sauber aufgeräumten Küche ließ Perkenson sich seufzend am Holztisch nieder. Fahles Licht fiel durch das Fenster, das im Gewitterwind vibrierte. Draußen prasselten Regentropfen auf das Fensterbrett.
»Meine Tochter ist eben erst gegangen«, meinte Perkenson. »Ihr Mann hat sie abgeholt.« Und in seltsam vertraulichem Ton: »Ich mag den Mann nicht. Hab den nie gemocht.«
»Besuch kann anstrengend sein«, antwortete er. Ihm war [8] nichts anderes eingefallen, er wollte nur das Gespräch in Gang halten, Stille hätte ihn noch nervöser werden lassen. Vorsichtig zog er die präparierten Utensilien aus der Tasche. »Die Spritze wird Ihnen gut tun«, sagte er. Für einen Moment hatte er überlegt, sie in die Luft zu halten, dem alten Mann zu zeigen, Arglosigkeit zu demonstrieren, aber irgendetwas hatte ihn zurückgehalten.
»Welche Spritze meinst du?«, fragte Perkenson plötzlich.
Er stutzte. »Na, die Vitamine…«
»Die was?«
Von einem Moment zum anderen schien sein Mund ausgetrocknet, und er hatte Mühe, das Wort herauszubringen: »VI-TA-MI-NE.«
Die Unsicherheit in seiner Stimme war nicht zu überhören gewesen. Hatte er sich womöglich geirrt? In der Akte Perkenson hatte er gelesen, dass einmal am Tag ein Pfleger beim pensionierten Postboten vorbeischauen müsse und eine Vitaminspritze zu geben sei. Perkenson sah ihn wieder stumm an, und er empfand ein leichtes Schwindelgefühl. Auf einmal hellten sich Perkensons Gesichtszüge auf, seine Augen bekamen einen freundlichen Ausdruck: »Ist in Ordnung. Ich bin kein Freund von Spritzen, hatte gehofft, du wüsstest vielleicht nicht Bescheid, dass ich Vitamine bekomme. Muss es heute denn sein?«
Er nickte. Spritzen zu setzen mochte er zwar überhaupt nicht, er hatte geradezu eine Aversion dagegen und hatte die auch nach jahrelanger Erfahrung nie ablegen können, aber heute Nachmittag musste es sein. Widerwillig und umständlich krempelte der alte Mann seinen Ärmel hoch und streckte den nackten Arm aus.
[9] Als er die Nadel ansetzte, wurde ihm für einen Moment wieder schwindelig. Dann presste er sie unter die Haut. Er musste einmal heftig schlucken, um die aufkommende Übelkeit zu verdrängen.
Noch während er den Kolben drückte, nahm er plötzlich wahr, dass Perkenson ihn musterte. »Das dauert sonst aber nicht so lange…«, meinte der.
Er antwortete darauf nicht, schaute konzentriert auf die Flüssigkeit, die langsam, aber unaufhörlich aus der Spritze verschwand. Als der Zylinder endlich leer war, zog er die Nadel erleichtert aus dem Arm, platzierte die Utensilien sorgfältig in die Tasche und setzte sich Perkenson gegenüber. Dessen Gesichtszüge hatten sich entspannt, er lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
Eine Weile saßen sie einfach nur stumm da.
Er beobachtete Perkenson genau, und ihm kam das Bild eines Jägers in den Sinn, der auf einen Löwen im hohen, trockenen Gras geschossen hat. Bevor er sein Opfer nicht von nahem begutachtet hat, kann der Jäger jedoch nicht mit Sicherheit wissen, ob das Tier tot ist. Er muss nachsehen und begibt sich dabei in Lebensgefahr.
Mit unbewegter Miene sah Perkenson aus dem Fenster in den aufgewühlten Himmel. Sein Blick folgte einem Vogel, der mühsam gegen den Wind anruderte. »Eine Möwe«, murmelte er. Dann wanderte sein Blick wieder zurück in die Küche, verharrte einen Moment auf dem vergilbten Kühlschrank, glitt über die leergeräumte Anrichte, auf der getrocknete Spuren eines Lappens sichtbar waren, und richtete sich schließlich auf ihn.
Wieder kam ihm der Jäger in den Sinn, der nach dem [10] Schuss in der feierlichen Stille mit vorsichtigen Schritten durch das hohe Gras schleicht, auf der Suche nach dem Löwen. Die Stille kann trügerisch sein und der Jäger im nächsten Moment von dem verletzten, aber noch mächtigen Tier angefallen und zerrissen werden.
Die Stille in der Küche wurde gerade drückend und unangenehm, als Perkensons knöchrige Finger auf den Tisch zu klopfen begannen. Es dauerte eine Weile, bis ein Rhythmus erkennbar wurde.
»Na, was ist das?«, fragte der alte Mann.
Er antwortete mit einem schwachen Schulterzucken. Der Rhythmus kam ihm irgendwie bekannt vor, mehr nicht.
»Das ist Swing«, sagte Perkenson und lächelte. Dann begann er mit brüchiger Stimme und etwas schief eine Melodie zu summen, die sich durch die Stille schlängelte.
Während er zuhörte, spürte er Schweiß auf der Stirn. Er fühlte sich zunehmend unwohl, die Situation drohte außer Kontrolle zu geraten. Er musste bald aus der Wohnung verschwinden, er durfte hier nicht gesehen werden, aber solange Perkenson noch so gut drauf war, war das nicht möglich. Er ging in Gedanken die letzten Minuten durch; war ihm irgendein Fehler unterlaufen?
Perkensons Darbietung endete mit einer Textzeile, die er mit einer tiefen und überraschend festen Stimme auf Englisch vortrug: »…it don’t mean a thing, if it ain’t got that swing!«
Er sah den alten Mann irritiert an, dessen Finger weiterhin auf den Tisch klopften. Aber etwas hatte sich verändert. Der Rhythmus war durcheinandergeraten. Die Finger klopften unkoordiniert herum, sie wurden langsamer. [11] Schließlich zuckten sie nur noch schwach. Die Hand lag matt auf dem Tisch. Als Perkenson langsam in seinen Stuhl zurücksackte, rutschte seine Hand schwer über das Holz.
»Sie werden jetzt sterben«, sagte er zu Karl...