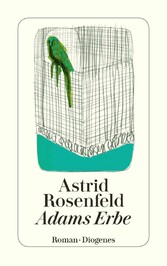Suchen und Finden
Service
Adams Erbe
Astrid Rosenfeld
Verlag Diogenes, 2012
ISBN 9783257602425 , 400 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[126] Ich wurde unmittelbar nach dem Krieg gezeugt. Es war die letzte Tat, die mein Vater, Maximilian Cohen, vollbrachte, bevor er sich in sein Zimmer einsperrte, um nie wieder herauszukommen. Das war 1919.
Mein älterer Bruder Moses und ich durften Vaters Zimmer nicht betreten. Dieses Verbot, gepaart mit Maximilian Cohens häufigen Schreien, zog mich geradezu magisch an. Ich habe ganze Nächte vor seiner Tür verbracht. Manchmal guckte ich durchs Schlüsselloch, so lange, bis ein Schuh oder ein Buch gegen die Tür flog. Ich kannte meinen Vater nur von einer Fotografie im Wohnzimmer.
Der zweite verführerische Ort war der Dachboden, auf dem Edda Klingmann wohnte. Edda ist meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, aber ich durfte sie weder Oma noch Großmutter nennen. Eine ganze Weile bestand sie darauf, dass Moses und ich sie mit Frau Klingmann anredeten. Man habe sie schließlich nicht gefragt, ob sie überhaupt Enkel haben und eine Oma sein wolle. Sie war erst Ende vierzig, als ich auf die Welt kam. In den ersten Jahren machte Frau Klingmann einen großen Bogen um mich, denn ein ständig heulendes Wesen, das in seine Windeln kackte, langweilte sie. Und sie zu langweilen war eine Todsünde.
Ich muss ungefähr fünf gewesen sein, als wir Freundschaft [127] schlossen und ich sie Edda nennen durfte. Moses war vier Jahre älter als ich, aber er und Frau Klingmann sind nie wirklich warm miteinander geworden. Nur ganz, ganz selten durfte auch er sie Edda nennen. Anfangs erlaubte Edda mir, sie einmal am Tag auf dem Dachboden zu besuchen. Ich musste anklopfen und warten, bis sie mich hereinbat, manchmal ließ sie mich über eine Stunde vor der Tür stehen.
Edda Klingmann war eine Walküre, groß und üppig mit einem gigantischen Busen. Sie trug mit Vorliebe hautenge, bodenlange rote Samtkleider. Ihre Haut war weiß wie Porzellan, ihre Augen blassgrün und ihr Haar schwarz mit einem Blaustich. Den verdankte sie Luigi, ihrem Friseur, der eigentlich Chaim hieß und Jude war, so wie wir. Aber Edda bestand auf einem italienischen Friseur.
»Adam, zum absoluten Glück einer Dame gehört ein italienischer Friseur, nur ein Italiener hat wirklichen Geschmack.«
So wurde aus Chaim Luigi. Und weil Chaim meine Großmutter verehrte, spielte er seine Rolle mit rührender Ernsthaftigkeit. Er eignete sich sogar einen italienischen Akzent an, den er später gar nicht mehr loswurde, was seine Frau fast in den Wahnsinn trieb.
Es war schwer, Edda Klingmann zu beeindrucken. Das Einzige, was sie wirklich beeindrucken konnte, war Schönheit. Sie beurteilte alle Menschen aufgrund ihres Äußeren und glaubte zudem, damit den Verlauf der Geschichte vorhersagen zu können.
»Adam, das ist eine Gabe, es ist wie Hellsehen. Ich wusste, dass wir den Krieg nicht gewinnen können. Schau dir Wilhelms Augen an, schau sie dir an, sie stehen ganz seltsam [128] beieinander, und Ludendorff hat kein Kinn. Ein Mann ohne Kinn.« Und dann nickte sie vielsagend.
Edda Klingmann rauchte 68 Zigaretten am Tag.
Ihr Mann, mein Großvater, den sie den Itzigen nannte, war lange vor meiner Geburt gestorben. Ein Pferd hatte ihm ins Gesicht getreten. Er war auf der Stelle tot.
»Adam, dein Großvater war ein Trottel, und er ist wie ein Trottel gestorben. Aber der Itzige war ein wunderschöner Mann, deshalb habe ich ihm alles verziehen. Auch die Sauferei.«
Wir sind Juden. Irgendwie. Seit dem Tod des Itzigen ging Oma nicht mehr in die Synagoge. Und Maximilian Cohen, dessen Urgroßvater ein Rabbiner gewesen war, glaubte einzig und allein an Deutschland, besser gesagt an den Kaiser. Meine Mutter aber, Greti Cohen, hat niemals aufgehört, zum Gott ihres Vaters zu beten. Sie war schwanger, als ihr Mann in den Krieg zog, um für sein geliebtes Kaiserreich zu kämpfen, und als sie ihren Sohn dann in den Armen hielt, gab sie ihm den Namen Moses und ließ ihn beschneiden. Bei der Rückkehr meines Vaters aus dem Krieg war Moses vier Jahre alt, und es war eindeutig zu spät, ihn noch umzubenennen oder die Vorhaut wieder anzunähen.
Als ich auf die Welt kam, hatte sich Maximilian schon weggesperrt. Trotzdem wagte meine Mutter es nicht, den gleichen Fehler noch einmal zu machen, deshalb wurde ich nicht beschnitten. Sie nannte mich Adam, nach dem einzigen Mann, der jemals das Paradies gesehen hat.
Ich glaube, Edda und ich wurden Freunde, weil sie mich hübsch fand. Ich hatte ihre Augen und die wohlgeformte [129] Nase des Itzigen. Moses hingegen sah aus wie Maximilian Cohen, dessen Wangenpartie, laut meiner Großmutter, »unvollendet« war. »Und das, Adam, verunstaltet das ganze Gesicht. Vielleicht würde ein Bart helfen.«
So richtig begann sich Edda allerdings erst für mich zu interessieren, als ich aus der Schule flog. Das geschah ziemlich bald nach meiner Einschulung. Ich konnte einfach nicht stillsitzen. Sosehr ich mich auch bemühte, meine Beine wollten mir nicht gehorchen. Meine Lehrer und der Direktor waren ratlos, weder Drohungen noch Schläge schafften es, meine Beine ruhigzustellen. Eines Tages brachte der Direktor mich persönlich nach Hause und teilte Greti Cohen und Edda Klingmann mit, dass man für mich eine andere Lösung finden müsse. Es gab eine Schule für bekloppte Kinder, da wollte man mich hinschicken. Meine Mutter heulte auf und prophezeite mir, ihrem jüngsten Sohn, ein schlimmes Ende. Edda Klingmann hingegen sorgte dafür, dass ich Privatunterricht bekam. In dem Moment, in dem die Schule und meine Mutter mich aufgaben, beschloss sie, dass Adam Cohen einmal Großes erreichen sollte. Von diesem Tag an musste ich nicht mehr anklopfen.
Herr Strund unterrichtete mich, ein pensionierter Lehrer mit Ziegenbart und einem herrlichen Mund.
»Adam, schau dir diese Lippen an, leicht aufgeworfen, nur ganz leicht, und dieses Rosa. Ich habe noch nie einen so wunderbaren Mund gesehen.«
Während Edda schwärmte, lief Strunds Gesicht im gleichen Rosa wie seine Lippen an.
Mein Privatlehrer war wohl eine von Eddas Liebschaften und reihte sich damit ein in eine Serie mehr oder minder [130] prominenter Männer. Das Prunkstück ihrer Sammlung war Hugo. Hugo Asbach, ein angesehener Weinbrandfabrikant. Ihm zu Ehren trank sie täglich mindestens drei Gläser Asbach. Und spätestens nach dem dritten Glas begann sie, Anspielungen zu machen.
»Ach, der Hugo…«
»Was war denn mit dem Hugo?«
Und dann lächelte sie und seufzte. »Das ist eine große Geschichte, Adam.«
Das Konkreteste, was ich je über die große Geschichte erfuhr, war, dass Hugo Asbach eine edle Stirn hatte. Einmal habe ich meine Mutter dazu befragt.
»Ach Adam, sei doch nicht so dumm, sie braucht einfach nur eine Entschuldigung, um zu trinken.«
Aber das wollte ich nicht glauben und werde es auch nie glauben.
Meine Mutter sah aus wie eine vertrocknete Blume, sprach stets leise und bewegte sich lautlos wie ein Gespenst durch die Wohnung. Nur wenn sie mir ein schlimmes Ende prophezeite, schepperte ihre Stimme, und manchmal stampfte sie sogar mit dem Fuß auf.
Sie war die Einzige, die das Zimmer ihres Mannes betreten durfte. Sie brachte ihm sein Essen, leerte seinen Nachttopf, wusch ihn, und vielleicht, aber da bin ich mir nicht sicher, unterhielten sie sich auch manchmal.
Früher fragte ich sie oft, ob mein Vater irgendwann rauskommen würde oder ob ich nicht vielleicht doch zu ihm reingehen dürfte. Die Antwort war immer nur ein Kopfschütteln. Ich wusste zwar, dass mein Land, das Land, das [131] mein Vater so sehr liebte, den Krieg verloren hatte. Dennoch verstand ich nicht, warum er sich deshalb wegschließen musste. Edda Klingmann versuchte, es mir zu erklären.
»Enttäuschung.«
»Wer hat ihn enttäuscht?«
»Wo soll ich anfangen? Seine Eltern, der Kaiser, die Heimat und schließlich deine Mutter. Und jetzt bleibt er lieber da, wo ihn niemand mehr enttäuschen kann.«
Weil mein Vater nicht mehr zur Verfügung stand, hatte Edda Klingmann das Kommando übernommen und sorgte für uns.
Einmal im Monat kam Herr Guldner aus der Schweiz, und wenn er auftauchte, musste ich den Dachboden verlassen. Sie machten Geschäfte miteinander. Selbst meine Mutter wusste nicht, was das für Geschäfte waren.
»Ich hoffe, es ist legal«, sagte sie manchmal mit ihrer leisen Stimme, aber deutlichere Kritik wagte sie nicht. Schließlich ernährten uns diese geheimnisvollen Geschäfte, und sie ernährten uns gut. Auch später, als andere ihr wertloses Geld säckeweise zum Bäcker schleppten, bezahlten wir mit Dollar. Lange Zeit hielt Edda Klingmann alle Sorgen von uns fern. Und so durfte ich mit dem Gefühl aufwachsen, dass mir nichts passieren konnte.
Strund gab sich alle Mühe mit meinem Unterricht, aber es ist wirklich schwer, jemandem, der ständig auf und ab geht, das Lesen und Schreiben beizubringen. Es dauerte fast zwei Jahre, bis ich es einigermaßen beherrschte. Und während ich mich mit dem Alphabet abmühte, das mir noch heute nicht logisch erscheinen will, suchte Edda nach [132] meinem verborgenen Talent. Weil Adam ja einmal Großes vollbringen würde.
»Strund, was meinen Sie, ist Adam ein Poet?«
»Puh«, machte der arme Strund. »Das… Wer weiß, wer weiß.«
Am nächsten Tag schenkte Edda mir ein in Leder gebundenes Notizbuch, und eine Woche später versammelte sich ein Großteil von »Eddas Mischpoke« auf dem Dachboden, um meine Gedichte zu hören. Es war eigentlich nur ein einziges Gedicht.
Moses half uns sämtliche Stühle nach oben tragen und zum Dank durfte er Frau Klingmann Edda nennen und an dieser denkwürdigen...