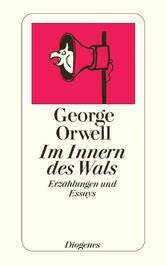Suchen und Finden
Service
Im Innern des Wals - Erzählungen und Essays
George Orwell
Verlag Diogenes, 2012
ISBN 9783257602470 , 176 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[7] Warum ich schreibe
Schon sehr früh, als ich vielleicht fünf oder sechs war, wollte ich Schriftsteller werden, wenn ich einmal groß sein würde. Zwischen siebzehn und vierundzwanzig versuchte ich den Gedanken aufzugeben, tat dies aber im Bewußtsein, daß ich damit gegen meine innerste Natur verstoßen und früher oder später mich doch hinsetzen und Bücher schreiben würde.
Ich war das mittlere von drei Kindern, von meinen beiden Geschwistern trennten mich jeweils fünf Jahre, und meinen Vater bekam ich vor meinem achten Lebensjahr nur selten zu Gesicht. Aus diesen und andern Gründen war ich recht einsam und entwickelte bald höchst unangenehme Eigentümlichkeiten, die mich während meiner ganzen Schulzeit unbeliebt machten. Ich hatte die Gewohnheit, die man oft bei sich selbst überlassenen Kindern findet, mir Geschichten auszudenken und mich mit imaginären Personen zu unterhalten, und ich glaube, daß meine literarischen Versuche von Anfang an von dem Gefühl begleitet waren, von den andern getrennt und nicht genügend anerkannt zu sein. Ich wußte, daß es mir leicht fiel, mich gewandt auszudrücken, und daß ich die Fähigkeit hatte, mich mit unerfreulichen Tatsachen auseinanderzusetzen, und so schuf ich meine eigene Welt, in der ich mich für die Enttäuschungen im Alltag entschädigen konnte. Dennoch erreichte der Umfang ernsthafter, das heißt ernsthaft angelegter Arbeiten, die ich während meiner Kindheit und frühen Jugend produzierte, noch nicht einmal ein halbes Dutzend Seiten. Mein erstes Gedicht, von meiner Mutter nach Diktat niedergeschrieben, verfaßte ich mit vier oder fünf Jahren. Ich kann mich an keine Zeile mehr erinnern und weiß nur, daß es von einem Tiger handelte und daß der Tiger »Zähne wie Stuhlreihen« hatte, eine recht gelungene Metapher, aber ich glaube, das Ganze war ein Plagiat von Blakes [8] Tiger, Tiger. Mit elf, bei Ausbruch des Krieges 1914 – 1918, schrieb ich ein patriotisches Gedicht, das in unserem Lokalblatt erschien, so wie ein zweites, zwei Jahre später, auf den Tod von Kitchener. Als ich schon etwas älter war, verfaßte ich ab und zu schlechte und gewöhnlich nie zu Ende gebrachte »Natur-Lyrik« im georgianischen Stil. Etwa zweimal versuchte ich mich auch an einer Kurzgeschichte, ein sagenhafter Mißerfolg; das war etwa alles an ernsthaften Bemühungen, was ich in der ganzen Zeit zu Papier brachte.
Immerhin habe ich in all diesen Jahren in gewissem Sinne doch eine literarische Tätigkeit ausgeübt. Da waren, um damit anzufangen, die bestellten Gelegenheitsarbeiten, die ich rasch, leicht und ohne große Befriedigung für mich selbst produzierte. Neben den Schularbeiten schrieb ich vers d’occasion, halb komische Gedichte, die ich mit einer, wie mir heute scheint, erstaunlichen Schnelligkeit hervorbrachte. Ich schrieb mit vierzehn in etwa einer Woche ein ganzes Theaterstück in Versen, in Anlehnung an Aristophanes, und war an der Herausgabe von Schülerzeitungen beteiligt, die teils gedruckt, teils als Manuskript erschienen. Diese Schülerzeitungen waren das Kläglichste und Komischste, was man sich vorstellen kann, und ich gab mir dabei weniger Mühe, als ich heute an die billigste journalistische Arbeit wenden würde. Aber gleichzeitig mit all dem führte ich fünfzehn Jahre oder länger eine literarische Vorübung ganz anderer Art durch: es war eine Konzeption einer fortlaufenden »Geschichte« über mich selbst, eine Art Tagebuch, das nur in meinem Kopf existierte. Ich glaube übrigens, daß es sich dabei um etwas handelt, was Kindern und Jugendlichen gemeinsam ist. Als ganz kleines Kind stellte ich mir schon vor, ich sei zum Beispiel Robin Hood, und ich sah mich als Helden erregender Abenteuer, aber bald drehte sich meine »Geschichte« nicht mehr ausschließlich in einer, grob gesagt, narzißtischen Weise um mich, sondern schilderte mehr und mehr all das, was ich tat und in meiner Umwelt sah. Minutenlang gingen mir Sätze wie diese durch den Kopf: »Er stieß die Tür auf und betrat den Raum. Ein gelber [9] Sonnenstrahl drang durch die Musselin-Vorhänge und fiel schräg auf den Tisch, wo eine halboffene Streichholzschachtel neben dem Tintenfaß lag. Die rechte Hand in der Tasche, durchquerte er den Raum bis zum Fenster. Unten auf der Straße haschte eine Schildpatt-Katze nach einem welken Blatt…« etc. etc. Diese Gewohnheit hielt etwa bis zu meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr an, also meine ganzen nicht-literarischen Jahre hindurch. Obwohl ich nach den richtigen Ausdrücken suchen mußte und auch suchte, unterzog ich mich der Mühe, alles genau zu schildern, fast gegen meinen Willen, wie unter einer Art von äußerem Zwang. In meiner »Geschichte« muß sich, wie ich annehme, der Stil der verschiedenen Autoren widergespiegelt haben, die ich je nach meinem Alter bewunderte, aber soweit ich mich erinnere, behielt ich meine peinlich genaue Milieuschilderung immer bei.
Mit etwa sechzehn Jahren entdeckte ich plötzlich die Freude am bloßen Wort, das heißt am Wortklang und der Assoziation von Worten. Die Zeilen in Paradise Lost:
So hee with difficulty and labour hard
Moved on: with difficulty and labour hee
[Mühselig und mit Arbeit hart,
bewegte er sich fort:
Mühselig und mit Arbeit hart],
die mir heute nicht mehr ganz so hinreißend erscheinen, jagten mir einen Schauer nach dem andern über den Rücken, wobei die Schreibweise von »hee« statt »he« mich noch zusätzlich entzückte. Die Technik, etwas zu beschreiben, war mir hinlänglich vertraut. Es liegt also auf der Hand, welche Art von Büchern ich schreiben wollte, soweit man davon sprechen kann, daß ich zu jener Zeit überhaupt Bücher schreiben wollte. Ich wollte große naturalistische Romane mit einem unglücklichen Ausgang machen, voll minuziöser Beschreibungen und überraschender [10] Vergleiche und ebenso reich an gedrechselten Passagen, in denen Worte hauptsächlich ihres Klanges wegen verwendet wurden. Tatsächlich kam mein erstes abgeschlossenes Buch Tage in Burma, das ich im Alter von dreißig Jahren schrieb, aber schon lange vorher mit mir herumgetragen hatte, dieser Art von Büchern ziemlich nah.
Ich schildere meinen Werdegang deshalb so eingehend, weil ich glaube, daß man die Motive eines Schriftstellers besser versteht, wenn man etwas über die Anfänge seiner Entwicklung weiß. Seine Stoffwahl ist durch die Epoche bestimmt, in der er lebt – zumindest gilt dies für eine so aufgewühlte, revolutionäre Zeit wie die unsere –, bevor er jedoch überhaupt zu schreiben beginnt, wird er bereits eine emotionale Haltung haben, von der er sich nie ganz freimachen wird. Es gehört zweifelsohne zu seinem Beruf, sein Temperament zu disziplinieren und zu vermeiden, in einer Phase der Unreife oder Un-Natur steckenzubleiben. Löst er sich aber völlig von den Einflüssen seiner Frühzeit, tötet er damit den Impuls seines Schaffens überhaupt. Abgesehen von der Notwendigkeit, Geld zu verdienen, glaube ich, daß es vier Hauptmotive dafür gibt, daß man schreibt, zumindest Prosa. Sie finden sich graduell verschieden bei jedem Schriftsteller, und verschieden stark je nach der Atmosphäre, in der er lebt. Es sind:
1. Reiner Egoismus. Der Wunsch, überlegen zu erscheinen, jemand zu sein, über den man spricht und den man auch nach seinem Tod nicht vergißt; den Erwachsenen die Nichtachtung heimzuzahlen, die sie einen als Kind haben fühlen lassen etc. etc. Leugnen zu wollen, daß das ein Grund ist, und zwar ein sehr starker, ist einfach lächerlich. Schriftsteller teilen diesen Charakterzug mit Wissenschaftlern, Künstlern, Politikern, Rechtsanwälten, Soldaten, erfolgreichen Geschäftsleuten, kurz, mit der gesamten Obergarnitur der Menschheit. Die große Masse menschlicher Wesen ist nicht so ausgesprochen ich-bezogen. Nach dreißig geben sie jeden individuellen Ehrgeiz auf – ja sie verlieren vielfach fast gänzlich das Gefühl für ihre eigene [11] Persönlichkeit – und leben hauptsächlich für andere oder werden einfach in der Knochenmühle der Alltagsarbeit aufgerieben. Dagegen steht eine Minderheit von begabten, selbstbewußten Menschen, die entschlossen sind, ihr eigenes Leben bis zum Ende zu leben, und zu ihnen gehören die Schriftsteller. Ernstzunehmende Schriftsteller sind meiner Meinung nach im allgemeinen eitler und egozentrischer als Journalisten, dafür weniger an Geld interessiert.
2. Ästhetischer Enthusiasmus. Sinn für die Schönheit der Umwelt oder für Worte und ihre richtige Anordnung. Freude an der Wechselwirkung von Klängen, an der Geschlossenheit guter Prosa oder dem Rhythmus einer guten Erzählung. Der Wunsch, mit andern ein Erlebnis zu teilen, das man als wertvoll empfindet und nicht in Vergessenheit geraten lassen möchte. Das ästhetische Motiv ist bei vielen Schriftstellern nur in geringem Maße vorhanden, aber selbst ein Pamphletist oder ein Verfasser von Lehrbüchern wird eine Liebe zu bestimmten Wörtern und Ausdrücken haben, die nicht zweckhaft bestimmt ist, oder ein Gefühl für die Typographie, die Breite des Buchrandes etc. etc. Von Kursbüchern abgesehen, ist kein Buch ganz frei von ästhetischen Erwägungen.
3. Sinn für Geschichte. Der Wunsch, die Dinge zu sehen, wie sie sind, den Wahrheitsgehalt von Ereignissen herauszufinden und sie für die Nachwelt aufzuzeichnen.
4. Politisches Engagement – wobei ich das Wort »politisch« im weitesten Sinne benutze. Der Wunsch, der Welt eine bestimmte Richtung zu geben, die Anschauungen anderer über ein gesellschaftliches Ideal zu verändern. Jedenfalls ist kein Buch wirklich frei von politischen Elementen. Wenn man behauptet, Kunst sollte...