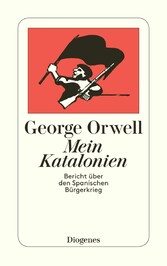Suchen und Finden
Service
Mein Katalonien - Bericht über den Spanischen Bürgerkrieg
George Orwell
Verlag Diogenes, 2012
ISBN 9783257602487 , 288 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[7] Erstes Kapitel
Einen Tag, ehe ich in die Miliz eintrat, sah ich in der Lenin-Kaserne in Barcelona einen italienischen Milizsoldaten, der vor dem Offizierstisch stand.
Er war ein zäher Bursche, fünf- oder sechsundzwanzig Jahre alt, mit rötlichgelbem Haar und kräftigen Schultern. Seine lederne Schirmmütze hatte er grimmig über ein Auge gezogen. Ich sah von der Seite, wie er, mit dem Kinn auf der Brust und einem verwirrten Stirnrunzeln, auf eine Karte starrte, die einer der Offiziere offen auf dem Tisch liegen hatte. Etwas in diesem Gesicht rührte mich tief. Es war das Gesicht eines Mannes, der einen Mord begehen oder sein Leben für einen Freund wegwerfen würde. Es war ein Gesicht, das man bei einem Anarchisten erwartete, obwohl er sehr wahrscheinlich ein Kommunist war. Offenherzigkeit und Wildheit lagen darin und gleichzeitig auch die rührende Ehrfurcht, die des Schreibens und Lesens unkundige Menschen ihren vermeintlichen Vorgesetzten entgegenbringen. Es war klar, daß er aus der Karte nicht klug werden konnte, sicherlich hielt er Kartenlesen für ein erstaunliches intellektuelles Kunststück. Ich weiß kaum, warum, aber ich habe selten jemand gesehen – ich meine einen Mann –, für den ich eine solch unmittelbare Zuneigung empfand. Während man sich am Tisch unterhielt, verriet eine Bemerkung, daß ich ein Ausländer war. Der Italiener hob seinen Kopf und sagte schnell: »Italiano?«
Ich antwortete in meinem schlechten Spanisch: »No, inglés; y tú?«
»Italiano.«
Als wir hinausgingen, schritt er quer durch das Zimmer und packte meine Hand mit hartem Griff. Seltsam, welche [8] Zuneigung man für einen Fremden fühlen kann! Es war so, als ob es seiner und meiner Seele für einen Augenblick gelungen sei, den Abgrund der Sprache und Tradition zu überbrücken und sich in völliger Vertrautheit zu treffen. Ich hoffte, daß er mich genauso gut leiden möge wie ich ihn. Ich wußte aber auch, daß ich ihn nie wiedersehen durfte, um an meinem ersten Eindruck von ihm festzuhalten. Es ist kaum nötig zu erwähnen, daß ich ihn wirklich nie wiedersah. In Spanien hatte man dauernd derartige Begegnungen.
Ich erwähne diesen italienischen Milizsoldaten, da er in meiner Erinnerung lebendig geblieben ist. In seiner schäbigen Uniform und mit seinem grimmigen, rührenden Gesicht ist er für mich ein typisches Bild der besonderen Atmosphäre jener Zeit. Er ist mit all meinen Erinnerungen an diesen Abschnitt des Krieges verknüpft: den roten Fahnen in Barcelona; den schlechten Zügen, die mit armselig ausgerüsteten Soldaten an die Front krochen; den grauen, vom Krieg angeschlagenen Städten hinter der Frontlinie und den schlammigen, eiskalten Schützengräben in den Bergen.
Das war Ende Dezember 1936. Kaum sieben Monate sind bis heute, während ich darüber schreibe, vergangen, und doch ist es ein Abschnitt, der schon in eine gewaltige Entfernung zurückgewichen ist. Spätere Ereignisse haben diese Zeit viel nachhaltiger verwischt als etwa meine Erinnerungen an 1935 oder sagen wir 1905. Ich war nach Spanien gekommen, um Zeitungsartikel zu schreiben. Aber ich war fast sofort in die Miliz eingetreten, denn bei der damaligen Lage schien es das einzig Denkbare zu sein, was man tun konnte. Die Anarchisten besaßen im Grunde genommen, noch immer die Kontrolle über Katalonien, und die Revolution war weiter in vollem Gange. Wer von Anfang an dort gewesen war, mochte vielleicht schon im Dezember oder Januar annehmen, daß sich die Revolutionsperiode ihrem Ende näherte. Wenn man aber gerade aus England kam, hatte der Anblick von Barcelona etwas [9] Überraschendes und Überwältigendes. Zum erstenmal war ich in einer Stadt, in der die arbeitende Klasse im Sattel saß. Die Arbeiter hatten sich praktisch jedes größeren Gebäudes bemächtigt und es mit roten Fahnen oder der rot und schwarzen Fahne der Anarchisten behängt. Auf jede Wand hatte man Hammer und Sichel oder die Anfangsbuchstaben der Revolutionsparteien gekritzelt. Fast jede Kirche hatte man ausgeräumt und ihre Bilder verbrannt. Hier und dort zerstörten Arbeitstrupps systematisch die Kirchen. Jeder Laden und jedes Café trugen eine Inschrift, daß sie kollektiviert worden seien. Man hatte sogar die Schuhputzer kollektiviert und ihre Kästen rot und schwarz gestrichen. Kellner und Ladenaufseher schauten jedem aufrecht ins Gesicht und behandelten ihn als ebenbürtig. Unterwürfige, ja auch förmliche Redewendungen waren vorübergehend verschwunden. Niemand sagte »Señor« oder »Don« oder sogar »Usted«. Man sprach einander mit »Kamerad« und »du« an und sagte »Salud!« statt »Buenos días«. Trinkgelder waren schon seit Primo de Riveras Zeiten verboten. Eins meiner allerersten Erlebnisse war eine Strafpredigt, die mir ein Hotelmanager hielt, als ich versuchte, dem Liftboy ein Trinkgeld zu geben. Private Autos gab es nicht mehr, sie waren alle requiriert worden. Sämtliche Straßenbahnen, Taxis und die meisten anderen Transportmittel hatte man rot und schwarz angestrichen. Überall leuchteten revolutionäre Plakate in hellem Rot und Blau von den Wänden, so daß die vereinzelt übriggebliebenen Reklamen daneben wie Lehmkleckse aussahen. Auf der Rambla, der breiten Hauptstraße der Stadt, in der große Menschenmengen ständig auf und ab strömten, röhrten tagsüber und bis spät in die Nacht Lautsprecher revolutionäre Lieder. Das Seltsamste von allem aber war das Aussehen der Menge. Nach dem äußeren Bild zu urteilen, hatten die wohlhabenden Klassen in dieser Stadt praktisch aufgehört zu existieren. Außer wenigen Frauen und Ausländern gab es überhaupt keine [10] »gutangezogenen« Leute. Praktisch trug jeder grobe Arbeiterkleidung, blaue Overalls oder irgendein der Milizuniform ähnliches Kleidungsstück. All das war seltsam und rührend. Es gab vieles, was ich nicht verstand. In gewisser Hinsicht gefiel es mir sogar nicht. Aber ich erkannte sofort die Situation, für die zu kämpfen sich lohnte. Außerdem glaubte ich, daß wirklich alles so sei, wie es aussah, daß dies tatsächlich ein Arbeiterstaat wäre und daß die ganze Bourgeoisie entweder geflohen, getötet worden oder freiwillig auf die Seite der Arbeiter übergetreten sei.
Ich erkannte nicht, daß sich viele wohlhabende Bürger einfach still verhielten und vorübergehend als Proletarier verkleideten.
Gleichzeitig mit diesen Eindrücken spürte man etwas vom üblen Einfluß des Krieges. Die Stadt machte einen schlechten, ungepflegten Eindruck, die Boulevards und Gebäude waren in einem dürftigen Zustand, bei Nacht waren die Straßen aus Furcht vor Luftangriffen nur schwach beleuchtet, die Läden waren meist armselig und halb leer. Fleisch war rar und Milch praktisch nicht zu erhalten, es gab kaum Kohle, Zucker oder Benzin, und Brot war wirklich sehr knapp. Schon zu dieser Zeit waren die Schlangen der Leute, die sich nach Brot anstellten, oft mehrere hundert Meter lang. Doch soweit man es beurteilen konnte, waren die Leute zufrieden und hoffnungsvoll. Es gab keine Arbeitslosigkeit, und die Lebenskosten waren immer noch äußerst niedrig. Auffallend mittellose Leute sah man nur selten und Bettler außer den Zigeunern nie. Vor allen Dingen aber glaubte man an die Revolution und die Zukunft. Man hatte das Gefühl, plötzlich in einer Ära der Gleichheit und Freiheit aufgetaucht zu sein. Menschliche Wesen versuchten, sich wie menschliche Wesen zu benehmen und nicht wie ein Rädchen in der kapitalistischen Maschine. In den Friseurläden hingen Anschläge der Anarchisten (die Friseure waren meistens Anarchisten), in denen ernsthaft erklärt wurde, die [11] Friseure seien nun keine Sklaven mehr. Farbige Plakate in den Straßen forderten die Prostituierten auf, sich von der Prostitution abzuwenden. Die Art, in der die idealistischen Spanier die abgedroschenen Phrasen der Revolution wörtlich nahmen, hatte für jeden Angehörigen der abgebrühten, höhnischen Welt der englisch sprechenden Völker etwas Rührendes. Man verkaufte damals in den Straßen für wenige Céntimos recht naive revolutionäre Balladen über die proletarische Brüderschaft oder die Bosheit Mussolinis. Ich habe öfters gesehen, wie ein des Lesens fast unkundiger Milizsoldat eine dieser Balladen kaufte, mit viel Mühe die Worte buchstabierte und sie dann, wenn er dahintergekommen war, zu der passenden Melodie sang.
Während der ganzen Zeit war ich in der Lenin-Kaserne, angeblich, um für die Front ausgebildet zu werden. Als ich in die Miliz eintrat, hatte man mir gesagt, daß ich am nächsten Tag zur Front geschickt werden solle. Aber in Wirklichkeit mußte ich warten, bis eine neue centuria zusammengestellt wurde. Die Arbeitermiliz, in aller Eile zu Beginn des Krieges von den Gewerkschaften aufgestellt, hatte man bis jetzt noch nicht nach dem Vorbild der regulären Armee organisiert. Kommandoeinheiten waren der ›Zug‹ (sección, d. Ü.) mit etwa dreißig Mann, die centuria mit etwa hundert Mann und die ›Kolonne‹ (columna, d. Ü.), praktisch nichts anderes als eine große Zahl Soldaten. Die Lenin-Kaserne bestand aus mehreren großartigen Steinbauten, einer Reitschule und weitläufigen, gepflasterten Höfen. Sie war früher als Kavalleriekaserne benutzt worden, die man während der Kämpfe im Juli erobert hatte. Meine centuria schlief in einem der Ställe unter den Steinkrippen, auf denen noch die Namen der Kavalleristen standen, die die Pferde zu versorgen hatten. Die Pferde hatte man erbeutet und an die Front geschickt, aber die Ställe stanken noch immer nach Pferdepisse und verfaultem Hafer. Ich blieb ungefähr eine Woche in...