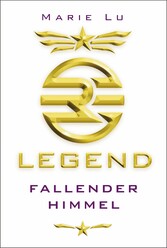Suchen und Finden
Service
Legend (Band 1) - Fallender Himmel - Spannende Trilogie über Rache, Verrat und eine legendäre Liebe ab 13 Jahre
Marie Lu
Verlag Loewe Verlag, 2013
ISBN 9783732000098 , 368 Seiten
3. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz DRM
DAY
Meine Mutter glaubt, dass ich tot bin.
Wie man sieht, bin ich nicht tot, aber es ist sicherer, sie in dem Glauben zu lassen.
Mindestens einmal pro Monat sehe ich mein Fahndungsfoto auf einem der JumboTrons, die über die ganze Innenstadt von Los Angeles verteilt sind. Es wirkt da oben immer völlig fehl am Platz. Meistens zeigen die riesigen Monitore fröhliche Bilder: lachende Kinder unter einem leuchtend blauen Himmel, Touristen, die vor den Ruinen der Golden Gate Bridge posieren, Republik-Werbespots in Neonfarben. Manchmal wird auch Propaganda gegen die Kolonien gesendet. Die Kolonien wollen uns unser Land wegnehmen, verkünden die Schlagzeilen. Sie neiden euch das, was ihr habt. Lasst nicht zu, dass sie euch eure Heimat rauben! Wehrt euch!
Und mittendrin meine Fahndungsanzeige. Sie lässt die JumboTrons in all ihrer bunten Pracht erstrahlen:
GESUCHT IM NAMEN DER REPUBLIK
Akten-Nr. 462178-3233 »DAY«
GESUCHT WEGEN KÖRPERVERLETZUNG, BRANDSTIFTUNG, DIEBSTAHLS, BESCHÄDIGUNG STAATLICHEN EIGENTUMS UND BEHINDERUNG MILITÄRISCHER EINSÄTZE
200 000 REPUBLIKNOTEN BELOHNUNG FÜR HINWEISE, DIE ZUR FESTNAHME FÜHREN
Die Meldung wird jedes Mal von einem anderen Foto begleitet. Einmal zeigt es einen Jungen mit Brille und einem wirren roten Lockenschopf. Ein anderes Mal einen Jungen mit schwarzen Augen und Glatze. Manchmal bin ich schwarz, manchmal weiß, dann wieder milchkaffeebraun oder gelb oder rot oder was ihnen sonst gerade in den Sinn kommt.
Mit anderen Worten: Die Republik hat keine Ahnung, wie ich aussehe. Sie scheinen insgesamt nicht besonders viel über mich zu wissen, außer dass ich jung bin und dass sie meine Fingerabdrücke so oft durch ihre Datenbanken jagen können, wie sie wollen – sie bekommen keinen Treffer. Darum hassen sie mich so, darum bin ich vielleicht nicht der gefährlichste Verbrecher des ganzen Landes, aber der meistgesuchte. Denn ich lasse sie ziemlich dumm aussehen.
Es ist erst früher Abend, aber draußen ist es schon stockdunkel und das Licht der JumboTrons spiegelt sich in den Pfützen auf der Straße. Ich setze mich auf ein bröckelndes Fensterbrett im dritten Stock, verborgen hinter rostigen Stahlträgern. Das hier war ursprünglich mal ein Wohngebäude, heute aber ist es total verfallen. Der Boden in diesem Zimmer ist mit kaputten Lampen und Glassplittern übersät und von den Wänden blättert die Farbe. In einer Ecke liegt ein altes Porträt unseres Elektors auf dem Boden. Ich frage mich, wer hier wohl gelebt hat – niemand wäre dumm genug, das Bild unseres Staatsoberhauptes so achtlos im Dreck liegen zu lassen.
Meine Haare habe ich wie immer unter eine alte Ballonmütze gestopft. Mein Blick ruht auf dem kleinen eingeschossigen Haus auf der anderen Straßenseite. Meine Finger spielen mit dem Anhänger, der an einer Schnur um meinen Hals hängt.
Tess lehnt an dem anderen Fenster im Zimmer und beobachtet mich. Ich bin unruhig an diesem Abend und wie immer kann sie es spüren.
Die Seuche hat den Lake-Sektor schwer erwischt. Im Schein der JumboTrons können Tess und ich die Soldaten am anderen Ende der Straße sehen. Sie inspizieren Haus für Haus und tragen ihre glänzend schwarzen Umhänge der Hitze wegen offen. Sie haben alle Gasmasken auf. Manchmal, wenn sie ein Haus wieder verlassen, markieren sie die Tür mit einem großen roten X. Danach betritt oder verlässt niemand mehr dieses Haus – zumindest nicht so, dass es jemand mitbekommt.
»Siehst du sie immer noch nicht?«, flüstert Tess. Ihr Gesichtsausdruck ist durch die Schatten verborgen.
Um mich ein bisschen abzulenken, bastele ich eine kleine Schleuder aus alten PVC-Schläuchen. »Sie haben überhaupt nicht zu Abend gegessen. Sie haben schon seit Stunden nicht mehr am Tisch gesessen.« Ich verlagere mein Gewicht und strecke mein schmerzendes Knie.
»Vielleicht sind sie gar nicht zu Hause?«
Ich werfe Tess einen verdrossenen Blick zu. Sie versucht nur, mich zu trösten, aber danach ist mir jetzt nicht zumute. »Es brennt Licht. Guck doch mal, die Kerzen. Mom würde nie Kerzen verschwenden, wenn keiner zu Hause wäre.«
Tess tritt neben mich. »Wir sollten die Stadt für ein paar Wochen verlassen, okay?« Sie versucht, ihre Stimme ruhig klingen zu lassen, aber die Angst sickert trotzdem durch. »Die Seuche ebbt bestimmt bald wieder ab, dann kannst du zurück und sie besuchen. Wir haben mehr als genug Geld für zwei Zugtickets.«
Ich schüttele den Kopf. »Einen Abend pro Woche, weißt du nicht mehr? Lass mich einen Abend pro Woche nach ihnen sehen.«
»Klar. Aber diese Woche bist du jeden Abend hergekommen.«
»Ich will nur sehen, ob es ihnen gut geht.«
»Was ist, wenn du krank wirst?«
»Das Risiko gehe ich ein. Und du hättest ja auch nicht mitkommen müssen. Du hättest genauso gut in Alta auf mich warten können.«
Tess zuckt mit den Schultern. »Irgendwer muss ja ein Auge auf dich haben.« Zwei Jahre jünger als ich – und manchmal klingt sie trotzdem, als wäre sie mein Kindermädchen.
Wir sehen eine Weile schweigend zu, wie sich die Soldaten immer weiter auf das Haus meiner Familie zubewegen. Jedes Mal, wenn sie vor einem Haus stehen bleiben, hämmert einer von ihnen laut an die Tür, während ein zweiter mit der Waffe im Anschlag daneben steht. Wenn innerhalb von zehn Sekunden niemand öffnet, tritt der erste Soldat die Tür ein. Sobald sie drinnen sind, kann ich sie nicht mehr sehen, aber ich kenne das Prozedere: Ein Soldat nimmt von jedem Familienmitglied eine Blutprobe, schiebt sie in ein tragbares Analysegerät und testet sie auf die Seuche. In zehn Minuten ist das Ganze vorbei.
Ich zähle die Häuser, die noch zwischen dem meiner Familie und den Soldaten liegen. Ich werde noch etwa eine Stunde warten müssen, bis ich ihr Schicksal erfahre.
Ein Schrei gellt vom anderen Ende der Straße durch die Dunkelheit. Mein Blick huscht in die Richtung, aus der er gekommen ist, und meine Hand schnellt zu dem Messer an meinem Gürtel. Tess atmet scharf ein.
Es ist ein Seuchenopfer. Die Frau muss schon seit Monaten dahinsiechen, denn ihre Haut ist überall aufgesprungen und blutig, und ich frage mich, wie die Soldaten sie bei ihren früheren Kontrollen übersehen konnten. Eine Weile taumelt sie orientierungslos umher, dann fängt sie plötzlich an zu rennen, nur um zu stolpern und auf die Knie zu fallen.
Ich blicke wieder zu den Soldaten. Jetzt sehen sie sie auch. Der mit der gezogenen Waffe nähert sich ihr, die übrigen elf bleiben zurück und sehen zu. Ein Seuchenopfer stellt keine große Bedrohung dar. Der Soldat hebt sein Gewehr und zielt. Funken stieben um die infizierte Frau auf.
Sie bricht zusammen und bleibt reglos liegen. Der Soldat gesellt sich wieder zu seinen Kameraden.
Ich wünschte, wir könnten irgendwie an eins von diesen Gewehren kommen. So eine nette, kleine Waffe kostet auf dem Schwarzmarkt nicht viel – 480 Noten, weniger als ein Herd. Wie alle Schusswaffen ist sie hochpräzise und nutzt magnetische und elektrische Felder, sodass man ein Ziel auf drei Häuserblocks Entfernung sicher trifft. Dad hat mal gesagt, dass sie diese Technologie bei den Kolonien geklaut haben, aber das würde die Republik natürlich nie zugeben. Wenn wir wollten, könnten Tess und ich uns fünf Stück davon kaufen … Über die Jahre haben wir uns angewöhnt, einen Teil des Geldes, das wir stehlen, zu horten und für Notfälle zu sparen. Aber das eigentliche Problem bei diesen Waffen sind nicht die Kosten. Man ist damit einfach zu leicht aufzuspüren. Jede von ihnen ist mit einem Sensor versehen, der Informationen über die Handform des Benutzers, seine Fingerabdrücke und seinen Aufenthaltsort speichert. Wenn sie mich auf diese Weise nicht schnappen würden, dann weiß ich auch nicht. Also bleibe ich lieber bei meinen selbst gebauten Waffen, Schleudern aus PVC und anderem Kinderspielzeug.
»Sie haben noch eins gefunden«, sagt Tess. Sie kneift die Augen zusammen, um besser sehen zu können.
Ich blicke nach unten und beobachte, wie die Soldaten aus einem weiteren Haus strömen. Einer von ihnen schüttelt eine Spraydose und sprüht ein riesiges rotes X an die Tür. Ich kenne dieses Haus. Zu der Familie, die dort wohnt, gehörte mal eine Tochter in meinem Alter. Als meine Brüder und ich noch klein waren, haben wir mit ihr gespielt – Blindekuh oder Straßenhockey mit alten Eisenstangen und Bällen aus zusammengeknülltem Papier.
Tess versucht mich abzulenken und deutet mit dem Kinn auf das Stoffbündel, das zu meinen Füßen liegt. »Was hast du ihnen mitgebracht?«
Ich lächele, dann bücke ich mich und knote das Päckchen auf. »Ein paar von den Sachen, die wir diese Woche zusammengetragen haben. Damit können sie ein bisschen feiern, wenn sie die Kontrolle überstanden haben.« Ich wühle in dem Sammelsurium von Mitbringseln und halte schließlich eine Schutzbrille hoch. Ich untersuche sie abermals, um sicherzugehen, dass das Glas nirgends gesprungen ist. »Für John. Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk.« Mein älterer Bruder wird diese Woche neunzehn. Er schiebt Vierzehnstundenschichten am Dampfkessel in einem nahe gelegenen Kraftwerk, und wenn er nach Hause kommt, tränen ihm immer die Augen von dem ganzen Dampf. Die Brille war ein richtiger Glücksfund, den wir in einer Lieferung von Militärausrüstung aufgestöbert haben.
Ich lege sie zurück und krame in den restlichen Sachen. Hauptsächlich Konserven mit Eintopf, die ich in der Cafeteria eines Luftschiffs geklaut habe, und ein altes Paar Schuhe mit völlig intakten Sohlen. Ich wünschte, ich könnte dabei...