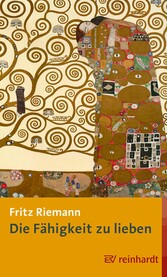Suchen und Finden
Service
Die Fähigkeit zu lieben - Bibliophile Ausgabe
Fritz Riemann
Verlag ERNST REINHARDT VERLAG, 2016
ISBN 9783497602766 , 184 Seiten
12. Auflage
Format PDF, ePUB, OL
Kopierschutz DRM
Die Fähigkeit zu lieben ist uns mitgegeben als eine Begabung, die wohl zu den größten Wundern des Lebens gehört. Denn ist es nicht ein Wunder, dass der Mensch, dieses egoistische, machthungrige, besitzgierige und erfolgsbesessene Wesen voller gefährlicher Triebe, Leidenschaften, Affekte und Aggressionen, überhaupt zu lieben fähig ist? Fähig ist, jemanden oder etwas zu lieben außer sich selbst, oder gar, wie es das Christentum fordert, zu lieben wie sich selbst? Ohne diese Fähigkeit zu lieben, die uns recht eigentlich erst zu Menschen werden lässt, wäre die Menschheit wohl längst ausgestorben, weil sie sich selbst vernichtet hätte.
Das Wesen der Liebe offenbart sich in unendlich vielfältigen Gestalten; das Gemeinsame, das, was letztlich die Liebe ausmacht, ist ganz schlicht der Wunsch, einem anderen wohltun zu wollen. Lieben ist ein Tun, eine Tätigkeit, kein Zustand. Wenn wir bei Tieren nicht von Liebe sprechen, sondern von Instinkten – beim Paarungstrieb, der Brutpflege und der Aufzucht der Jungen –, wenn wir die Bezeichnung „lieben“ nur für den Menschen vorbehalten, wollen wir damit offenbar ausdrücken, dass Liebe beim Menschen mehr ist als ein bloßes Instinktverhalten, mehr auch als ein sexueller oder gar gattungserhaltender Trieb, dass zu alldem etwas hinzukommen muss, was es erst im Bereich des Menschlichen gibt. Dieses Etwas ist begrifflich-rational schwer zu fassen; hier scheitert unser Bemühen, die Liebe zu erklären, zu definieren oder, wie wir das heute auf so vielfältige Weise versuchen, machbar zu machen.
Über die Liebe zu sprechen oder zu schreiben sollte daher eigentlich den Liebenden und den Dichtern vorbehalten bleiben, denen also, die von ihr ergriffen sind. Wenn sich dagegen die Wissenschaft ihrer bemächtigt, bleibt von der Liebe oft wenig mehr übrig als Triebe, Reflexe und scheinbar machbare oder erlernbare Verhaltensweisen, als biologische Daten, messbare physiologische und testbare psychologische Reaktionen, die zwar alle auch zu dem Phänomen Liebe gehören, mit denen wir es aber nicht erfassen. Dem Wesen der Liebe kommen wir damit nicht näher, denn sie ist etwas, das aus der Ganzheit unseres Wesens, aus unserer Gesamtpersönlichkeit kommt und sich nicht aus der Sicht einer Teilwissenschaft erklären noch sich durch irgendwelche Techniken erlernen lässt. Sowenig eine gekonnte Technik allein den Künstler ausmacht, sowenig macht eine gekonnte sexuelle Technik den Liebenden aus. Programmierte Streicheleinheiten sowie erlernbare Verhaltensweisen einem Partner gegenüber lassen keine Erlebnisweise gleichsam züchten, die aus unserer Wesensmitte kommt – wenn Lieben so einfach machbar und zu erlernen wäre, hätten wir es längst gelernt. All solche Rezepte können allenfalls den Boden vorbereiten helfen, auf dem Liebe erwachsen kann, und sie haben ihre Bedeutung; aber wenn sie mit dem Anspruch auftreten, Liebe lehren zu können, ist das irreführend. Wie der Glaube nicht von der Anzahl der Gebete, erfüllter Rituale oder der Kirchenbesuche abhängt, sondern etwas ist, das mit unserer Gesamtpersönlichkeit zusammenhängt, mit unserer ganzen Lebensführung und Lebenseinstellung, so ist auch die Liebe Ausdruck unserer Gesamtpersönlichkeit und hängt von deren Dimension, Reife und Tiefe ab, nicht von der Häufigkeit sexueller Akte oder der Anzahl von Liebeserlebnissen.
Aber es gibt offenbar recht verschiedene Vorstellungen davon, was wir unter Liebe verstehen; der eine meint damit höchste Sinnenlust, ein anderer höchstmögliche Steigerung seiner Erlebnisfähigkeit, ein Dritter sieht in ihr den Sinn seines Lebens, wieder ein anderer die höchste Vervollkommnung der Beziehung zweier Menschen zueinander oder deren Erhebung ins Überzeitliche; manche halten sie für eine Illusion oder gar für eine Krankheit.
Alles Liebenkönnen setzt zunächst einmal unsere Liebesfähigkeit voraus, und über diese Liebesfähigkeit können wir mancherlei aussagen. Vorerst, dass sie sich den verschiedensten Objekten zuwenden kann: Sie ist nicht geschlechtsgebunden, denn es gibt auch die gleichgeschlechtliche Liebe, die sich außer in der Wahl eines gleichgeschlechtlichen Partners in nichts von einer heterosexuellen Liebe zu unterscheiden braucht. Die Liebe ist auch nicht altersgebunden, denn wir begegnen ihr auf allen Altersstufen; sie nimmt auch nicht immer die gleiche Form an, denn die Mutterliebe ist eine andere als die zwischen Mann und Frau; wir kennen die geschlechtliche Liebe und die platonisch-verehrende, die karitative und die allgemeine Menschenliebe. Und unsere Liebesfähigkeit ist nicht einmal allein auf Menschen beschränkt: Wir können auch die Natur oder die Tiere lieben, die Kunst oder unseren Beruf, ja sogar etwas Abstraktes oder eine Idee – denken wir etwa an die Vaterlandsliebe, die Wahrheitsund Gerechtigkeitsliebe oder an die Liebe zum Schicksal oder auch die Liebe zu Gott.
Wenn wir bei alldem von Liebe sprechen, muss damit etwas gemeint sein, was unabhängig davon ist, wem sie sich zuwendet, müssen wir offenbar eine Liebesfähigkeit oder eine Liebesbereitschaft besitzen, die sich betätigen will und sich jemanden oder etwas sucht, den sie lieben kann. Für diese Liebesfähigkeit ist es anscheinend charakteristisch, dass sie in allen ihren Formen uns von uns fort-, über uns hinausführen will, dass sie mit dem Drang verbunden ist, uns jemandem liebend zuzuwenden oder einem Etwas, das nicht wir selbst sind. So ist das Gemeinsame bei allen Formen des Liebens offensichtlich eine gewisse Selbstentäußerung, ein grenzüberschreitendes Transzendieren, das wohl letztlich aus der Sehnsucht stammt, die trennende Schranke zwischen uns und einem Du oder zwischen uns und etwas, das anders oder mehr ist als wir selbst, zu überwinden oder wenigstens vorübergehend aufzuheben.
Vielleicht haben wir damit die tiefste Wurzel alles Liebenwollens verstanden: die Sehnsucht, die einengenden Grenzen unserer Ichhaftigkeit, unserer Ichbezogenheit zu überschreiten und durchlässig zu werden für etwas außer uns selbst, dem wir uns liebend zuwenden. Und diese liebende Zuwendung bedeutet zunächst ganz schlicht, dass wir dem wohlwollen, dem sie gilt, worin wohl die allgemein gültigste Form alles Liebens besteht.
Unser Leben ist aber auf allen Ebenen und immer antinomisch angelegt; alles Leben spielt sich zwischen polaren, jedoch sich ergänzenden Impulsen ab. So steht der Liebesbereitschaft, der liebenden Hinwendung auf anderes als uns selbst, unser Selbsterhaltungstrieb gegenüber, nach dem, wie das Sprichwort sagt, jeder sich selbst der Nächste ist. Zwischen diesen beiden Urgewalten spielt sich letztlich unser Leben ab: Auf der Seite der Liebesbereitschaft im weitesten Sinne liegt unser Bedürfnis nach Kommunikation, nach Hingabe und dem Austausch zwischen Ich und Nicht-Ich, nach jenem grenzüberschreitenden Transzendieren, das uns uns selbst vergessen lässt; und auf der Seite der Selbsterhaltung liegt unser Bedürfnis nach Selbstbewahrung und Abgrenzung, nach Unabhängigkeit und Autonomie unserer Persönlichkeit, letztlich nach Selbstverwirklichung. Selbstbewahrung und Selbsthingabe sind wohl die beiden tiefsten Strebungen unseres Lebens; beide sind uns angeboren und insofern nicht mehr ableitbar zu uns gehörend; sie ergänzen sich gegenseitig, bedingen einander und machen uns in ihrer Ergänzung überhaupt erst lebensfähig, wie wir es am klarsten schon an der Atmung sehen können: Der rhythmische Wechsel von Einatmen und Ausatmen ist die erste Grundbedingung unseres Lebendigseins, ohne die wir nicht existieren können, und darüber hinaus vielleicht ein Gleichnis dafür, dass alles Leben solchem rhythmischen Wechsel unterliegt, den wir auch in der Systole (Zusammenziehung) und Diastole (Ausdehnung) des Herzens und in allen Stoffwechselvorgängen wiederfinden.
Dieser Vorgang des Ein- und Ausatmens, in dem wir gleichsam die Urform der Selbstbewahrung und der Selbsthingabe sehen können, hat aber noch einen eigentümlichen Aspekt, den wir im Allgemeinen nicht beachten. Oskar Adler hat ihn gleichnishaft einmal so beschrieben: Wenn wir einatmen, atmet der Kosmos gleichsam in uns aus, und wenn wir ausatmen, atmet uns der Kosmos gleichsam ein. Fühlen wir uns in dieses wechselseitige Geschehen tiefer ein, müssen wir wohl daraus folgern, dass wir in allem lebendigen Geschehen immer zugleich Subjekt und Objekt sind. In diesem Gleichnis ist die Vielschichtigkeit aller Lebensvorgänge angedeutet, der immerwährende Austausch zwischen Handeln und Erleiden, Geben und Empfangen, dem wir auch in der Liebe immer wieder begegnen. Denn auch in der Liebe sind wir immer Subjekt und Objekt zugleich. Die einseitige Redeweise von einem „Liebesobjekt“, die in der Psychoanalyse üblich ist, bezieht diese Vielschichtigkeit nicht ein und erweckt in uns die Illusion, die allein Handelnden zu sein – eine Selbsttäuschung, die hier wie auf anderen Lebensgebieten verhängnisvoll geworden ist und deren Folgen wir heute bitter genug erfahren; denn wir haben die Welt zu einseitig zu einem Objekt gemacht, das wir glaubten uneingeschränkt ausbeuten zu können, und nun werden wir durch die Folgen unseres Tuns und Verhaltens, die wie ein Bumerang auf uns zurückkommen, zum Objekt gemacht.
Vielleicht ist das „Sexualobjekt“, wie die Psychoanalyse den jeweiligen Liebespartner zu bezeichnen pflegt, eine männliche Erfindung, zugleich eine grobe Vereinfachung – sehen wir im Partner ein Liebes- oder Sexual„objekt“, machen wir ihn zum nur Empfangenden, an und mit dem etwas geschieht oder getan wird, das er scheinbar passiv mit sich geschehen lässt. Aber wo im Bereich des Lebens gibt es das jemals in einer zwischenmenschlichen Kommunikation, geschweige denn in der Liebe?
Jede Aktion setzt unvermeidlich eine Reaktion, und wo wir allein handelndes Subjekt zu...