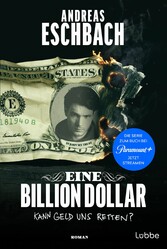Suchen und Finden
Service
Eine Billion Dollar - Roman
Andreas Eschbach
Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, 2009
ISBN 9783838700571 , 893 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
PROLOG
ENDLICH ÖFFNETEN SICH zwei Türflügel vor ihnen, und sie betraten einen von geradezu überirdischem Licht erfüllten Raum. Ein großer, ovaler Tisch aus dunklem Holz beherrschte seine Mitte, davor standen zwei Männer und sahen ihnen erwartungsvoll entgegen.
»Mister Fontanelli, ich darf Ihnen meine Partner vorstellen«, meinte der junge Anwalt, nachdem er die Türen hinter ihnen geschlossen hatte. »Zunächst meinen Vater, Gregorio Vacchi.«
John schüttelte die Hand eines streng dreinblickenden, etwa fünfundfünfzigjährigen Mannes, der einen grauen, einreihigen Anzug trug und eine Brille mit schmalem Goldrand und der mit seinem dünn werdenden Haar etwas von einem Buchhalter an sich hatte. Man konnte ihn sich als Anwalt für Steuerfragen vorstellen, vor den Schranken eines Verwaltungsgerichts mit dünnlippigem Mund trockene Paragrafen aus dem Handelsrecht zitierend. Sein Händedruck fühlte sich kühl an, geschäftsmäßig, und er murmelte etwas von »erfreut, Sie kennen zu lernen«, wobei man nicht den Eindruck hatte, dass er wusste, was das hieß: sich zu freuen.
Der andere Mann war wohl noch etwas älter, wirkte aber mit seinem vollen, lockigen Haar und seinen buschigen Augenbrauen, die seinem Gesichtsausdruck etwas Düsteres verliehen, wesentlich vitaler. Er trug einen Zweireiher, dunkelblau, mit einer streng konventionellen Klubkrawatte und einem formvollendet gesteckten Kavalierstuch. Ihn konnte man sich vorstellen, wie er, ein Glas Champagner in der Hand, in einer Edelkneipe den Sieg in einem aufsehenerregenden Mordprozess feierte und zu vorgerückter Stunde Kellnerinnen lachend in den Hintern zwickte. Sein Händedruck war fest, und er sah John fast unangenehm tief in die Augen, als er sich mit dunkler Stimme vorstellte: »Alberto Vacchi. Ich bin Eduardos Onkel.«
Erst jetzt bemerkte John, dass in einem ausladenden Ohrensessel vor einem der Fenster noch jemand saß – ein alter Mann, der die Augen geschlossen hielt, aber nicht so wirkte, als schlafe er wirklich. Eher, als sei er zu erschöpft, um sich allen Sinnen aussetzen zu können. Sein faltiger Hals ragte mager aus dem weichen Kragen eines Hemdes, über dem er eine graue Strickweste trug. Auf dem Schoß hatte er ein kleines Samtkissen liegen, auf dem wiederum seine gefalteten Hände ruhten.
»Der Padrone«, sagte Eduardo Vacchi leise, der Johns Blick bemerkt hatte. »Mein Großvater. Wie Sie sehen, sind wir ein Familienunternehmen.«
John nickte nur, wusste nicht, was er sagen sollte. Er ließ sich zu einem Stuhl dirigieren, der einsam an der einen Breitseite des Konferenztisches stand, und folgte der Einladung einer Hand, sich zu setzen. Auf der gegenüberliegenden Tischseite standen vier Stühle nebeneinander, die Lehnen ordentlich an die Tischkante gerückt, und auf den Plätzen vor diesen Lehnen lagen dünne Aktenmappen aus schwarzem Leder, in das ein Wappen geprägt war.
»Wollen Sie etwas trinken?«, wurde er gefragt. »Kaffee? Mineralwasser?«
»Kaffee, bitte«, hörte John sich sagen. In seinem Brustkorb rührte sich wieder jenes flatternde Gefühl, das aufgetaucht war, als er die Halle des Waldorf-Astoria-Hotels betreten hatte.
Eduardo verteilte Kaffeetassen, die auf einem kleinen fahrbaren Beistelltisch ordentlich aufgestellt bereitstanden, stellte Sahnekännchen und Zuckerstreuer aus getriebenem Silber dazu, schenkte überall ein und stellte die Kanne neben Johns Tasse ab. Die drei Vacchis nahmen Platz, Eduardo auf der Seite, die von John aus gesehen rechts lag, Gregorio, der Vater, neben ihm, und Alberto, der Onkel, wiederum neben diesem. Der vierte Platz, ganz links, blieb leer.
Ein allgemeines Sahneeingießen, Zuckerstreuen und Kaffeeumrühren setzte ein. John starrte auf die wunderbare, mahagonirote Maserung der Tischplatte. Das musste Wurzelholz sein. Während er seinen Kaffee umrührte, mit einem schweren, silbernen Kaffeelöffel, versuchte er, sich unauffällig umzusehen.
Durch die Fenster hinter den drei Anwälten ging der Blick weit hinaus über ein helles, flirrendes New York, in dessen Schluchten das Sonnenlicht tanzte, und auf einen East River, der in tiefem, hellgesprenkeltem Blau glänzte. Rechts und links der Fenster fielen duftige, lachsfarbene Vorhänge herab, die einen vollendeten Kontrast zu dem schweren, makellos dunkelroten Teppichboden und den schneeweißen Wänden bildeten. Unglaublich. John nippte an seinem Kaffee, der stark und aromatisch schmeckte, eher wie der Espresso, den ihm seine Mutter manchmal machte.
Eduardo Vacchi öffnete die Mappe, die vor ihm lag, und das verhaltene Geräusch, das das Leder des Einbands auf der Tischplatte machte, klang wie ein Signal. John stellte seine Tasse zurück und holte noch einmal Luft. Es ging los.
»Mister Fontanelli«, begann der junge Anwalt und beugte sich dabei leicht vor, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, die Hände gefaltet. Sein Tonfall war jetzt nicht mehr verbindlich, sondern sozusagen amtlich. »Ich hatte Sie gebeten, einen Identitätsnachweis zu diesem Gespräch mitzubringen – Führerschein, Reisepass oder dergleichen –, nur der Form halber, versteht sich.«
John nickte. »Mein Führerschein. Moment.« Er griff hastig in seine Gesäßtasche, erschrak, als er nichts fand, bis ihm einfiel, dass er den Führerschein in die Innentasche seines Jacketts gesteckt hatte. Mit heißen, beinahe bebenden Fingern reichte er das Papier über den Tisch. Der Anwalt nahm den Führerschein entgegen, musterte ihn flüchtig und reichte ihn dann mit einem Kopfnicken an seinen Vater weiter, der ihn im Gegensatz dazu so eingehend studierte, als sei er überzeugt, es mit einer Fälschung zu tun zu haben.
Eduardo lächelte leicht. »Auch wir haben einen Identitätsnachweis dabei.« Er zog zwei große, äußerst amtlich aussehende Papiere hervor. »Die Familie Vacchi ist seit mehreren Jahrhunderten in Florenz ansässig, und fast alle männlichen Mitglieder dieser Familie sind seit Generationen als Rechtsanwälte und Vermögensverwalter tätig. Das erste Dokument bestätigt dies; das zweite ist eine englische Übersetzung des ersten Dokuments, beglaubigt vom Staate New York.« Er reichte John die beiden Papiere, der sie ratlos musterte. Das eine, eingelegt in eine Klarsichthülle, schien ziemlich alt zu sein. Ein italienischer Text, von dem John nur jedes zehnte Wort verstand, war mit Schreibmaschine auf ergrautes, wappengeprägtes Papier getippt, und zahllose ausgeblichene Stempel und Unterschriften drängten sich darunter. Die englische Übersetzung, ein sauberer Laser-Ausdruck, versehen mit einer Gebührenmarke und einem notariellen Stempel, klang verwirrend und ziemlich juristisch, und soweit John sie verstand, bestätigte sie, was der junge Vacchi gesagt hatte.
Er legte beide Urkunden vor sich hin, verschränkte die Arme. Einer seiner Nasenflügel zuckte; hoffentlich sah man das nicht.
Wieder faltete Eduardo die Hände. Johns Führerschein war inzwischen bei Alberto angelangt, der ihn wohlwollend nickend betrachtete und dann bedächtig in die Mitte des Tisches schob.
»Mister Fontanelli, Sie sind Erbe eines beträchtlichen Vermögens«, begann Eduardo erneut, wieder in förmlichem Ton. »Wir sind hier, um Ihnen die Höhe der betreffenden Summe und die Randbedingungen des Erbes mitzuteilen und, falls Sie sich bereit erklären, das Erbe anzutreten, mit Ihnen die Schritte zu besprechen, die für die Eigentumsübertragung notwendig sind.«
John nickte ungeduldig. »Ähm, ja – könnten Sie mir zuerst mal sagen, wer überhaupt gestorben ist?«
»Wenn Sie gestatten, möchte ich die Antwort auf diese Frage noch einen Moment zurückstellen. Es ist eine längere Geschichte. Jedenfalls ist es niemand aus Ihrer unmittelbaren Verwandtschaft.«
»Und wieso erbe ich dann etwas?«
»Das lässt sich, wie gesagt, nicht in ein oder zwei Sätzen erklären. Deswegen bitte ich Sie, sich noch zu gedulden. Im Moment ist die Frage: Sie sollen eine beträchtliche Menge Geld erhalten – wollen Sie es haben?«
John musste unwillkürlich auflachen. »Okay. Wie viel?«
»Über achtzigtausend Dollar.«
»Sagten Sie achtzigtausend?«
»Ja. Achtzigtausend.«
Mann! John lehnte sich zurück, atmete pfeifend aus. Puh. Mann, o Mann. Acht-zig-tau-send! Kein Wunder, dass sie vier Mann hoch angereist waren. Achtzigtausend Dollar, das war eine ordentliche Summe. Wie viel war denn das? Auf einen Schlag! Mann, Mann! Auf einen Schlag, das musste man erst einmal verdauen. Das hieß ... Mann, das hieß, er konnte aufs College gehen, locker konnte er das, ohne auch nur noch eine blöde Stunde bei irgendeinem blöden Pizzaservice oder sonst wo jobben zu müssen. Achtzigtausend ... Mann, auf einen Schlag! Einfach so! Unglaublich. Wenn er ... Okay, er musste aufpassen, dass ihn nicht der Größenwahn befiel. Er konnte in der Wohngemeinschaft bleiben, die war okay, nicht luxuriös, aber wenn er sparsam lebte – Mann, es würde noch für einen Gebrauchtwagen reichen! Dazu ein paar gute Klamotten. Dies und das. Ha! Und keine Sorgen mehr.
»Nicht schlecht«, brachte er schließlich heraus. »Und was wollen Sie jetzt von mir wissen? Ob ich das Geld nehme oder nicht?«
»Ja.«
»Mal ’ne ganz dumme Frage: Ist denn ein Haken bei der Sache? Erbe ich irgendwelche Schulden mit oder so was?«
»Nein. Sie erben Geld. Wenn Sie zustimmen, erhalten Sie das Geld und können damit machen, was Sie wollen.«
John schüttelte fassungslos den Kopf. »Können Sie sich vorstellen, dass ich dazu Nein sage? Können Sie sich vorstellen, dass irgendjemand dazu Nein sagt?«
...