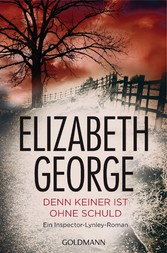Suchen und Finden
Service
Denn keiner ist ohne Schuld - Roman
Elizabeth George
Verlag Goldmann, 2013
ISBN 9783641118686 , 640 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
NOVEMBER: REGEN
Cappuccino – das neue Mittel gegen Weltschmerz und Depression. Ein wenig Espresso, ein Schuß geschäumter heißer Milch, dazu eine im allgemeinen geschmacklose Prise Kakaopulver, und schon war angeblich alles wieder in Butter. So ein Blödsinn!
Deborah St. James seufzte. Sie nahm die Quittung, die eine vorüberkommende Kellnerin ihr diskret auf den Tisch gelegt hatte.
»Wahnsinn!« sagte sie und starrte bestürzt und verärgert auf den geforderten Betrag. Dabei hätte sie sich eine Straße weiter in ein Pub setzen und damit die hartnäckige innere Stimme befriedigen können, die ihr immer wieder gesagt hatte: Was soll dieses Schicki-Micki-Gehabe, Deb? Du kannst doch genausogut irgendwo ein simples Guinness trinken. Aber nein, sie hatte ins Upstairs gehen müssen, das aufgedonnerte, von Marmor und Glas blitzende Café des Savoy Hotels, wo jeder, der etwas anderes als Wasser trank, für dieses Privileg teuer bezahlen mußte.
Deborah war ins Savoy gekommen, um ihre Mappe zu präsentieren – einem jungen, aufstrebenden Produzenten namens Richie Rica, der im Auftrag eines neugegründeten Unternehmens der Unterhaltungsbranche namens L. A. Sound Machine arbeitete. Der junge Mann war einmal eben für sieben Tage nach London gekommen, um einen Fotografen zu suchen. Rica hatte den Auftrag bekommen, das neueste Album von Dead Meat, einer fünfköpfigen Band aus Leeds, vom Entwurf bis zur Fertigstellung zu betreuen. Sie sei, bemerkte er, als Deborah kam, »der neunte beschissene Knipser«, dessen Arbeiten er sich ansehen müsse. Er hatte offensichtlich keine Lust mehr.
Daran änderte leider auch ihr Gespräch nichts. Rittlings auf einem zierlichen vergoldeten Stuhl sitzend, ging Rica ihre Mappe mit dem Interesse und dem Tempo eines Kartengebers in einem Spielcasino durch. Eine nach der anderen segelten Deborahs Aufnahmen zu Boden. Sie sah zu, wie sie abstürzten: ihr Mann, ihr Vater, ihre Schwägerin, ihre Freunde, die neuen Verwandten, die sie durch ihre Heirat gewonnen hatte. Kein Sting oder Bowie oder George Michael war unter ihnen. Sie hatte den Termin sowieso nur der Empfehlung eines Kollegen zu verdanken, dessen Arbeit dem Amerikaner nicht zugesagt hatte. Nach Ricas Miene zu urteilen, würde auch sie nicht weiterkommen als alle anderen.
Aber das kümmerte sie weniger als das ständige Anwachsen des grauweißen Felds von Fotografien neben Ricas Stuhl. Unter ihnen war eine Aufnahme ihres Mannes, und seine Augen – seine hellen, graublauen Augen, die scharf gegen sein schwarzes Haar abstachen – schienen sie direkt anzusehen. Flucht ist nicht der Weg, schien er zu sagen.
Immer dann, wenn Simon im Grunde recht hatte, wollte sie ihm einfach nicht glauben. Das war die Hauptschwierigkeit in ihrer Ehe: ihre Weigerung, Gefühlsregungen vor Augen Vernunft walten zu lassen, ihre ständige Fehde mit seiner kühlen Beurteilung der gegebenen Fakten. Verdammt noch mal, Simon, rief sie dann, sag mir nicht, was ich für Gefühle habe, du kennst meine Gefühle nicht ... Und am heftigsten, am bitterlichsten pflegte sie zu weinen, wenn sie wußte, daß er recht hatte.
So wie jetzt, da er fast hundert Kilometer entfernt in Cambridge eine Tote untersuchte und eine Serie Röntgenbilder studierte, um mit der ihm eigenen unbestechlichen Sachlichkeit festzustellen zu versuchen, mit was für einer Waffe das Gesicht dieses fremden toten Mädchens entstellt worden war.
Schließlich kam Richie Rica mit Märtyrermiene wegen der immensen Vergeudung seiner kostbaren Zeit zu einem Urteil: »Okay, das ist ja ganz nett, aber wollen Sie die Wahrheit wissen? Mit den Bildern da ließe sich Scheiße nicht mal verkaufen, wenn sie vergoldet wäre.« Deborah nahm die Aussage betont cool. Erst als er, in der Absicht aufzustehen, seinen Stuhl zurückschob, fing ihr leise schwelender Unmut Feuer. Er schob seinen Stuhl nämlich mitten in das Meer von Fotografien, das er auf dem Boden geschaffen hatte, und eines der Stuhlbeine durchbohrte das faltige Gesicht ihres Vaters, wobei ein klaffender Riß entstand.
Doch auch das brachte ihr Blut eigentlich noch nicht in Wallung. Genaugenommen war es Ricas lässiger Kommentar: »O Mist, tut mir leid. Aber Sie können den Alten ja noch mal abziehen, oder?«
Sie kniete nieder, sammelte ihre Bilder ein, legte sie wieder in die Mappe, band die Mappe zu, sah dann auf und sagte: »Sie sehen eigentlich gar nicht aus wie ein Ignorant. Warum benehmen Sie sich dann wie einer?«
Womit natürlich – ganz abgesehen einmal vom künstlerischen Wert der Bilder – feststand, daß sie den Auftrag nicht bekommen würde.
Es hat eben nicht sollen sein, Deb, hätte ihr Vater gesagt. Das war natürlich richtig. Es gab vieles im Leben, was nicht sein sollte.
Sie nahm ihre Umhängetasche, ihre Mappe, ihren Schirm und ging durch das riesige Foyer hinaus. Ein paar Schritte an den wartenden Taxis vorbei, und sie war draußen auf dem Bürgersteig. Der morgendliche Regen hatte für einen Augenblick nachgelassen, aber es blies ein scharfer Wind, wie er in London gern herrschte; ein Wind, der aus dem Südosten angefegt kommt, über dem offenen Wasser Geschwindigkeit zulegt und dann durch die Straßen pfeift und Schirme und Kleider packt. Deborah sah blinzelnd in den Himmel. Graue Wolken türmten sich übereinander. Es konnte sich nur um Minuten handeln, ehe es erneut zu regnen anfangen würde.
Sie hatte vorgehabt, ein Stück spazierenzugehen. Sie war nicht weit vom Fluß, und ein Spaziergang das Embankment hinunter erschien ihr ungleich verlockender als die Rückkehr in ein Haus, das bei diesem Wetter düster war und in dem noch ihre letzte unerfreuliche Auseinandersetzung mit Simon nachhallte. Doch in Anbetracht des Windes, der ihr die Haare in die Augen schlug, und der regenschweren Luft überlegte sie es sich anders.
Kurz darauf stand sie gepufft und gestoßen mitten im Gedränge im Bus und fand schon nach wenigen Metern Fahrt, daß ein Marsch selbst im tobenden Sturm dieser Busfahrt eindeutig vorzuziehen sei: Sie war so eingepfercht, daß sie kaum atmen konnte; ein von Kopf bis Fuß in Burberry gekleideter Fremder malträtierte mit der Spitze seines Regenschirms ihre kleine Zehe, und die reizende, großmütterlich aussehende alte Dame neben ihr verströmte penetranten Knoblauchgeruch – das genügte, um Deborah davon zu überzeugen, daß dieser Tag nur noch schlimmer werden konnte.
An der Craven Street brach der Verkehr zusammen. Weitere acht Personen nutzten die Gelegenheit, um sich in den Bus zu drängen. Es begann zu regnen. Scheinbar als Reaktion auf die sich ständig verschlimmernde Situation stieß die reizende alte Dame einen tiefen Seufzer aus, und der Burberry-Mensch stützte sich mit seinem gesamten Gewicht auf seinen Schirm. Deborah versuchte, die Luft anzuhalten; ihr wurde flau.
Nichts – nicht Sturm und Regen, nicht einmal eine Begegnung mit allen vier Reitern der Apokalypse zugleich – konnte schlimmer sein als dies. Nicht einmal ein zweites. Gespräch mit Richie Rica. Während der Bus im Schneckentempo in Richtung Trafalgar Square kroch, kämpfte sich Deborah an fünf Skinheads, zwei Punks, einem halben Dutzend Hausfrauen und einer fröhlich schnatternden Gruppe amerikanischer Touristen vorbei. Als die Nelson-Säule in Sicht kam, hatte sie den Ausgang erreicht und rettete sich mit einem resoluten Sprung hinaus in Wind und Regen.
Sie wußte, daß es keinen Sinn hatte, den Schirm aufzuspannen. Der Wind würde ihn packen und wie einen Fetzen Papier die Straße hinunterwirbeln. Statt dessen suchte sie daher einen geschützten Winkel. Der Platz selbst war wie leergefegt, eine große nackte Betonfläche mit ein paar Springbrunnen und ein paar steinernen Löwen. Ohne die Scharen von Tauben, die sich hier niedergelassen hatten, und ohne die Obdachlosen und Freudlosen, die sonst immer bei den Brunnen oder auf den Löwen hockten und die Touristen ermunterten, die Vögel zu füttern, gehörte der Platz ausnahmsweise einmal tatsächlich dem Heldenmonument, das auf ihm stand. Drüben, auf der anderen Seite, war die National Gallery, wo einige Menschen in ihre Mäntel schlüpften, mit Regenschirmen kämpften und wie die Mäuse die breiten Stufen hinaufhuschten. Dort war man vor Wind und Wetter geschützt. Dort gab es zu essen und zu trinken, wenn Deborah das wollte. Kunst, wenn sie das brauchte. Und verlockende Ablenkung, wie sie Deborah in den letzten acht Monaten bewußt gesucht hatte.
Der Regen begann schon durch ihre Haare bis auf die Kopfhaut durchzudringen, als sie die Treppe zum Fußgängertunnel hinunterlief und wenig später auf dem Platz selbst wieder an die Oberfläche kam. Ihre schwarze Mappe fest an sich gedrückt, überquerte sie ihn schnell. Als sie den Museumseingang erreichte, schwamm sie in ihren Schuhen, ihre Strümpfe waren von oben bis unten bespritzt, ihr Haar fühlte sich auf ihrem Kopf an wie eine feuchte Wollmütze.
Und wohin nun? Sie war seit einer Ewigkeit nicht mehr in der National Gallery gewesen. Wie peinlich, dachte sie. Und ich will Künstlerin sein!
Tatsache jedoch war, daß sie sich in Museen unweigerlich überwältigt fühlte, nach spätestens einer Viertelstunde erschlagen vom ästhetischen Overkill. Andere konnten umhergehen, schauen und, die Nasen keine zehn Zentimeter von der Leinwand entfernt, ihre Kommentare zum Pinselstrich geben. Deborah brauchte nur zehn Gemälde weit zu gehen, und schon hatte sie das erste vergessen.
Sie gab ihre Sachen an der Garderobe ab, nahm sich einen Plan des Museums und begann ihre Wanderung, froh, der Kälte entronnen zu sein, dankbar bei dem Gedanken, daß das Museum wenigstens vorübergehend eine Atempause erlaubte. Ein Fotoauftrag, der sie abgelenkt hätte, mochte im Augenblick außer...