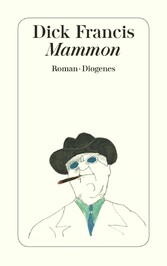Suchen und Finden
Service
Mammon
Dick Francis
Verlag Diogenes, 2014
ISBN 9783257606195 , 480 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[7] 1
Die fünfte Frau meines Vaters war mir zutiefst unsympathisch, aber für einen Mord hätte es nicht gereicht.
Ich, das Resultat seines zweiten unbesonnenen Galopps vor den Traualtar, war pflichtbewußt zu seinen beiden nächsten Hochzeiten gegangen, als mir mit sechs und mit vierzehn eine neue »Mutter« beschert wurde.
Mit dreißig hatte ich allerdings rebelliert: Keine zehn Pferde hätten mich dazu gebracht, die Vermählung mit der kaltäugigen, glattzüngigen Moira, seiner fünften Auserwählten, mitzufeiern. Moira war der Gegenstand des erbittertsten Streits gewesen, den mein Vater und ich jemals hatten, und die unmittelbare Ursache einer Dürreperiode des Nichtmiteinandersprechens, die drei Jahre anhielt.
Nachdem Moira ermordet worden war, stattete mir die Polizei einen höchst argwöhnischen Besuch ab, und nur rein zufällig konnte ich beweisen, daß ich an einem anderen Ort gewesen war, als ihre habgierige kleine Seele ihren sorgsam gepflegten Körper verlassen hatte. Ich ging nicht zu ihrer Beerdigung, doch da war ich nicht der einzige. Mein Vater ging auch nicht hin.
Einen Monat nach ihrem Tod rief er mich an, und ich [8] hatte seine Stimme so lange nicht mehr gehört, daß sie mir wie die eines Fremden vorkam.
»Ian?«
»Ja«, sagte ich.
»Malcolm.«
»Hallo«, sagte ich.
»Bist du beschäftigt?«
»Ich lese die Goldnotierungen.«
»Nein, verdammt«, sagte er gereizt. »Allgemein – bist du sehr beschäftigt?«
»Allgemein«, sagte ich, »ziemlich.«
Die Zeitung lag auf meinem Schoß, ein leeres Weinglas stand vor mir. Es war später Abend, nach elf, zunehmend kühl. Ich hatte an diesem Tag meinen Job aufgegeben und den Müßiggang übergestreift wie einen behaglichen Mantel.
Er seufzte durch die Leitung. »Ich nehme an, du weißt von Moira?«
»Titelseitennachricht«, bejahte ich. »Der Goldpreis steht auf… ehm, Seite 32.«
»Falls du möchtest, daß ich mich entschuldige«, sagte er, »das werde ich nicht tun.«
Ich sah sein Bild klar und deutlich vor mir: ein stämmiger grauhaariger Mann mit leuchtend blauen Augen und einer knisternden Vitalität, die er wie Funken statischer Elektrizität versprühte. Er war meiner Ansicht nach starrsinnig, selbstherrlich, unvorsichtig und oft dumm. Er war außerdem in finanziellen Dingen intuitiv schlau, gewieft und couragiert und hatte nicht umsonst den Spitznamen Midas bekommen.
[9] »Bist du noch da?« wollte er wissen.
»Ja.«
»Also… ich brauche deine Hilfe.«
Er sagte das, als wäre es ein alltägliches Bedürfnis, aber ich konnte mich nicht entsinnen, daß er schon jemals irgendwen um Hilfe gebeten hätte; mich ganz bestimmt nicht.
»Ehm…«, sagte ich unsicher. »Welche Art von Hilfe?«
»Erzähle ich dir, wenn du herkommst.«
»Wohin denn?«
»Nach Newmarket«, sagte er. »Komm morgen nachmittag zur Auktion.«
Man konnte seinen Tonfall zwar nicht flehend nennen, aber es war alles andere als ein direkter Befehl, und ich war nur Befehle gewohnt.
»In Ordnung«, sagte ich langsam.
»Gut.«
Er legte sofort auf, ließ mich keine Fragen stellen, und ich dachte an meine letzte Begegnung mit ihm – wie ich versucht hatte, ihn von der Heirat mit Moira abzubringen, indem ich sie angesichts seiner felsenfesten Absicht allmählich steigernd zunächst als bösen Fehlgriff seinerseits bezeichnete, dann als eine geschickte, unehrliche Manipulatorin und schließlich als ein raffgieriges, blutsaugerisches Biest. Er hatte mich mit einem einzigen, raschen, furchtbaren Schlag zu Boden gestreckt, wozu er vor drei Jahren – mit fünfundsechzig – durchaus noch in der Lage war. Wütend war er hinausmarschiert, während ich benommen auf meinem Teppich lag, und danach hatte er sich verhalten, als gäbe es mich nicht mehr; alles, was noch von [10] mir in meinem alten Zimmer in seinem Haus war, hatte er in Kisten gepackt und von einem Spediteur in meine Wohnung bringen lassen.
Die Zeit hatte mir recht gegeben mit Moira, doch die unverzeihlichen Worte waren mir bis zu ihrem Tod nicht verziehen worden und allem Anschein nach auch danach nicht. An diesem Oktoberabend jedoch waren sie vielleicht vorübergehend auf Eis gelegt.
Ich, Ian Pembroke, das fünfte der neun Kinder meines Vaters, hatte ihn von den Nebeln des Säuglingsalters an blind geliebt, durch sturmgezauste Jahre häuslicher Nahkämpfe hindurch, die mich für immer unempfindlich gegen Stimmengewalt und zuschlagende Türen machten. Die völlig konfusen, chaotischen Umstände, unter denen ich aufwuchs, hatten es mit sich gebracht, daß ich hin und wieder zwar eine unbehagliche Zeit bei meiner verbitterten Mutter abbüßte, gewöhnlich aber im Haus meines Vaters von einer Frau zur nächsten weitergereicht wurde wie zum Inventar gehörig, während er mir durchweg die gleiche beiläufige, aber ehrliche Zuneigung erwies, die er auch seinen Hunden schenkte.
Erst mit der Ankunft von Coochie, seiner vierten Frau, war einmal Frieden eingekehrt, aber als sie die Zügel in die Hand nahm, war ich bereits vierzehn, hatte die Nase voll und erwartete zynisch, daß noch im Jahr der Flitterwochen die Feindseligkeiten wiederaufleben würden.
Mit Coochie jedoch war es anders gekommen. Coochie war mir von allen die einzige richtige Mutter gewesen, die einzige, die mir ein Gefühl von Wert und Identität vermittelt, die zugehört, ermutigt und gute Ratschläge gegeben [11] hatte. Coochie brachte Zwillinge zur Welt, meine Halbbrüder Robin und Peter, und es hatte ausgesehen, als wäre Malcolm Pembroke endlich zu einer heilen, intakten Familie gelangt, wenn man sie auch mit einer sonnigen Lichtung inmitten eines Uwalddickichts aus Exfrauen und unzufriedenen Sprößlingen vergleichen konnte.
Ich wuchs heran und ging weg von zu Hause, kehrte aber oft zurück und fühlte mich nie ausgeschlossen. Coochie hätte Malcolm bis ins hohe Alter glücklich gemacht, doch als sie vierzig war und die Zwillinge elf, drängte ein anderer Fahrer, der anschließend das Weite suchte, ihren Wagen von der Straße ab, so daß er an einem Felsenabhang zerschellte. Coochie und Peter waren sofort tot. Robin, der erstgeborene Zwilling, erlitt einen Gehirnschaden. Ich war damals nicht zu Hause. Malcolm war in seinem Büro: Ein Polizist brachte ihm die Nachricht, und kurz darauf verständigte er mich. An jenem feuchtkalten Nachmittag lernte ich, was Kummer hieß, und ich trauere immer noch um sie; ihr Verlust ist unwiederbringlich.
An dem Oktoberabend des Telefongesprächs mit Malcolm warf ich wie gewohnt beim Schlafengehen einen Blick auf ihre drei lebhaften Gesichter, die mich aus einem Silberrahmen auf meiner Kommode angrinsten. Robin lebte – gerade so – in unbeschwertem Dämmerzustand in einem Pflegeheim. Ich besuchte ihn dann und wann. Er sah nicht mehr wie der Junge auf dem Foto aus, sondern war fünf Jahre älter, sehr viel größer, und sein Blick war leer.
Ich fragte mich, was für ein Anliegen Malcolm haben könnte. Er war reich genug, um sich alles Nötige zu [12] kaufen, vielleicht – aber nur vielleicht – mit Ausnahme von Fort Knox. Mir fiel nichts ein, was ich für ihn tun könnte, das er nicht von jemand anders hätte bekommen können.
Newmarket, dachte ich. Die Auktionen.
Für mich war Newmarket ein Begriff, da ich als Assistent eines Trainers gearbeitet hatte. Aber Newmarket und Malcolm? Malcolm setzte nie auf Pferde, nur auf Gold. Malcolm hatte ein ständig wachsendes, ungeheures Vermögen durch den Kauf und Verkauf des gelben Metalls erworben, und meinen Berufswunsch hatte er vor Jahren lediglich mit den Worten kommentiert: »Pferde? Rennsport? Guter Gott! Tja, wenn du das machen willst, Junge, dann nichts wie ran. Aber denk nicht, daß ich davon auch nur den Schimmer einer Ahnung habe.« Und soviel ich wußte, war er auf dem Gebiet noch so unbeschlagen wie eh und je.
Malcolm und die Vollblutauktionen von Newmarket, das paßte einfach nicht zusammen. Jedenfalls nicht mit dem Malcolm, den ich kannte.
Ich fuhr am nächsten Tag in die abgelegene Stadt in Suffolk, deren Hauptgeschäft der Sport der Könige ist, und in der bunten, zielstrebigen Menschenmenge sah ich meinen Vater barhäuptig vor der Auktionshalle stehen, in einen Katalog vertieft.
Er sah unverändert aus. Grauer Bürstenschnitt, glatter brauner Vikunjamantel, knielang, anthrazitfarbener Straßenanzug, Seidenkrawatte, blanke schwarze Schuhe; selbstbewußt reihte er sich in seiner städtischen Eleganz in die zwanglosere Eleganz des ländlichen Rahmens ein.
[13] Es war ein sonniger Tag, frisch und klar, der Himmel ein kaltes, wolkenloses Blau. Ich ging in meiner selbstgewählten Arbeitskleidung zu ihm hinüber: lange Reithose, kariertes Wollhemd, olivgrüne Steppjacke, Tweedmütze. Ein äußerlicher Gegensatz, der bis in die Persönlichkeit hineinreichte.
»Guten Tag«, sagte ich neutral.
Er hob die Augen, und sein Blick war so blau wie der Himmel.
»Du bist also gekommen.«
»Ja… schon.«
Er nickte unbestimmt, während er mich musterte. »Du siehst älter aus«, sagte er.
»Drei Jahre.«
»Drei Jahre, und eine krumme Nase«, bemerkte er nüchtern. »Ich nehme an, die hast du dir beim Sturz von einem Pferd gebrochen?«
»Nein… Du hast sie mir gebrochen.«
»So?« Er schien nur leicht überrascht zu sein. »Du hattest es verdient.«
Ich gab keine Antwort. Er zuckte die Achseln. »Möchtest du...