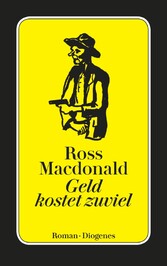Suchen und Finden
Service
Geld kostet zuviel
Ross Macdonald
Verlag Diogenes, 2016
ISBN 9783257607628 , 325 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
2
Wie ein Abhang im Fegefeuer stieg die Pacific Street aus der armen Unterstadt zu dem Viertel aus schönen alten Häusern hoch, das auf dem Hügel lag. Das im spanischen Stil erbaute Haus der Chalmers war sicherlich fünfzig oder sechzig Jahre alt; seine weißen Mauern wirkten jedoch in der späten Morgensonne makellos.
Ich durchquerte den ummauerten Hof und klopfte an die eisenbeschlagene Haustür. Ein dunkelgekleideter Diener mit einem Gesicht, das in ein spanisches {12}Kloster gehörte, öffnete, fragte nach meinem Namen und ließ mich in der großen Diele stehen. Diese Diele war ein riesiger zweigeschossiger Raum, in dem ich mir klein, aber dann – als Reaktion – groß und selbstbewußt vorkam.
Ich konnte in die große weiße Höhle des Wohnzimmers blicken. An seinen Wänden leuchteten moderne Gemälde. Der Zugang war mit Gittern aus schwarzem Schmiedeeisen bewehrt, schulterhoch, so daß man sich wie in einem Museum vorkam.
Dieser Eindruck wurde teilweise durch die dunkelhaarige Frau gestört, die vom Garten hereinkam, um mich zu begrüßen. In den Händen hielt sie eine Rosenschere und eine helle rote Olé-Rose. Die Schere legte sie auf einen Tisch in der Diele; die Rose, deren Farbe genau zu der ihrer Lippen paßte, behielt sie dagegen in der Hand.
Ihr Lächeln war strahlend und besorgt. »Irgendwie habe ich Sie mir älter vorgestellt.«
»Ich bin älter, als ich aussehe.«
»Ich hatte John Truttwell ausdrücklich gebeten, mir den Leiter der Agentur zu schicken.«
»Ich bin eine Ein-Mann-Agentur. Falls es nötig ist, arbeite ich mit anderen Privatdetektiven zusammen.«
Sie krauste die Stirn. »Das klingt meinem Gefühl nach nicht gerade überzeugend. Mit den Pinkertons scheint man Sie nicht vergleichen zu können.«
»Ich bin keine Großfirma – wenn Sie das meinten.«
»Das nicht. Ich brauche jedoch einen erfahrenen Mann, einen wirklich erfahrenen. Haben Sie Erfahrung im Umgang mit gut …« Ihre freie Hand deutete erst {13}auf sich selbst und dann auf ihre Umgebung. »… mit Menschen wie mir?«
»Um diese Frage beantworten zu können, kenne ich Sie noch nicht gut genug.«
»Sie sind es doch, über den wir jetzt sprechen.«
»Ich nehme an, daß Mr. Truttwell mich empfohlen hat und Ihnen mitteilte, daß ich Erfahrung besitze.«
»Ich habe doch das Recht, meine eigenen Fragen zu stellen, nicht wahr?«
Ihr Ton war einerseits herausfordernd; andererseits fehlte es ihm an Selbstsicherheit. Es war der Tonfall einer hübschen Frau, die Geld und gesellschaftliches Ansehen geheiratet hat und nie vergißt, daß sie diese Dinge genauso leicht wieder verlieren kann.
»Also stellen Sie Ihre Fragen, Mrs. Chalmers.«
Sie merkte, daß ich sie ansah, und hielt meinen Blick fest, als versuchte sie, meine Gedanken zu lesen. Ihre Augen waren schwarz, hellwach und undurchdringlich.
»Ich möchte lediglich folgendes wissen: Wenn Sie die Florentiner Dose finden – John Truttwell hat Ihnen wahrscheinlich von der goldenen Dose erzählt?«
»Er sagte, daß sie verschwunden sei.«
Sie nickte. »Angenommen, Sie finden sie und bekommen heraus, wer sie mitgenommen hat – ist die Angelegenheit dann damit erledigt? Ich meine: Sie werden dann doch nicht zu den Behörden laufen und sie über alles informieren?«
»Nein. Es sei denn, die Behörden wurden bereits eingeschaltet.«
»Das sind sie nicht, und das werden sie auch nicht«, sagte sie. »Ich möchte, daß diese ganze Angelegenheit {14}unter uns bleibt. Eigentlich hatte ich sogar nicht einmal die Absicht, John Truttwell von der Dose zu erzählen, aber er hat es mir entlockt. Allerdings vertraue ich ihm. Wenigstens glaube ich es.«
»Und mir glauben Sie nicht vertrauen zu können?«
Ich lächelte, und sie entschloß sich, mein Lächeln zu erwidern. Mit ihrer roten Rose berührte sie meine Wange; dann ließ sie sie auf den Fliesenboden fallen, als hätte die Blume ihren Zweck erfüllt. »Kommen Sie in das Arbeitszimmer. Dort sind wir unter uns.«
Über eine kurze Treppe führte sie mich zu einer reichgeschnitzten Eichentür. Bevor sie sie hinter uns schloß, sah ich noch, daß der Diener in der Empfangshalle erst die Schere und dann die Rose an sich nahm.
Das Arbeitszimmer war ein spärlich möblierter Raum mit dunklen Balken, die die abgeschrägte weiße Decke stützten. Das einzige kleine Fenster, vor dem sich ein Gitter befand, trug dazu bei, daß es wie eine Gefängniszelle wirkte. Als hätte der Gefangene nach einem Ausweg gesucht, standen an einer Wand Regale mit alten juristischen Büchern.
An der gegenüberliegenden Wand hing ein großes Gemälde, anscheinend ein Ölbild von Pacific Point in alten Zeiten, dessen Perspektive primitiv war. Ein Segelschiff aus dem 17. Jahrhundert lag im Hafen innerhalb der Landzunge; daneben lungerten nackte braune Indianer am Strand. Über ihren Köpfen marschierten spanische Soldaten wie eine Armee am Himmel.
Mrs. Chalmers bot mir einen alten, mit Kalbsleder bezogenen Drehstuhl vor einem geschlossenen Rollpult an.
»Diese Stücke passen nicht zu den übrigen Möbeln«, {15}sagte sie, als wäre es wichtig. »Aber das hier war der Schreibtisch meines Schwiegervaters, und in dem Sessel, in dem Sie jetzt sitzen, saß er immer bei Gericht. Er war Richter.«
»Das erzählte mir Mr. Truttwell bereits.«
»Ja, John Truttwell kannte ihn. Ich selbst habe ihn nie kennengelernt. Er starb vor langer Zeit, als Lawrence noch ein kleiner Junge war. Aber mein Mann verehrt immer noch alles, was mit seinem Vater zusammenhängt.«
»Ich würde mich freuen, Ihren Mann ebenfalls kennenzulernen. Ist er zu Hause?«
»Leider nicht. Er ist zum Arzt gegangen. Diese Einbruchsgeschichte hat ihn sehr aufgeregt.« Und sie fügte hinzu: »Außerdem möchte ich auch nicht, daß Sie mit ihm sprechen.«
»Weiß er, daß ich hier bin?«
Sie entfernte sich von mir und beugte sich über einen schwarzen eichenen Refektoriumstisch. Aus einem silbernen Kästchen nahm sie eine Zigarette und zündete sie mit einem dazu passenden Tischfeuerzeug an. Die Zigarette, an der sie heftig zog, legte einen blauen Rauchschleier zwischen uns.
»Lawrence hielt es für eine schlechte Idee, einen Privatdetektiv einzuschalten. Trotzdem beschloß ich, Sie zu engagieren.«
»Was hatte er dagegen einzuwenden?«
»Mein Mann liebt sein Privatleben. Und die Dose, die gestohlen wurde – mein Gott, sie war ein Geschenk, das seine Mutter von einem ihrer Verehrer bekommen hatte. Eigentlich soll ich es gar nicht wissen, {16}aber ich weiß es doch.« Ihr Lächeln war verzerrt. »Außerdem bewahrte seine Mutter in dieser Dose die Briefe auf.«
»Die Briefe des Verehrers?«
»Die Briefe meines Mannes. Während des Krieges hatte Larry ihr eine Menge Briefe geschrieben, und diese Briefe bewahrte sie in der Dose auf. Die Briefe sind übrigens auch verschwunden – nicht, daß sie von großem Wert sind, ausgenommen vielleicht für Larry.«
»Ist die Dose wertvoll?«
»Ich glaube schon. Sie ist vergoldet und sehr sorgfältig gearbeitet. Es handelt sich um eine Florentiner Arbeit aus der Renaissance.« Sie stolperte über das Wort, bekam es dann jedoch heraus. »Auf dem Deckel befindet sich ein Bild – zwei Liebende.«
»Ist sie versichert?«
Sie schüttelte den Kopf und kreuzte die Beine. »Das schien nicht nötig. Wir haben sie nie aus dem Safe genommen. Nie sind wir auf den Gedanken gekommen, der Safe könnte aufgebrochen werden.«
Ich bat darum, den Safe sehen zu dürfen. Mrs. Chalmers nahm das primitive Gemälde mit den Indianern und den spanischen Soldaten ab. Wo es gehangen hatte, war ein großer zylindrischer Safe in die Mauer eingelassen. Sie drehte mehrmals an der Scheibe und öffnete den Safe. Über ihre Schulter hinweg konnte ich erkennen, daß der Safe denselben Durchmesser wie ein Geschützrohr vom Kaliber 40 Zentimeter hatte und genauso leer war.
»Wo haben Sie Ihren Schmuck, Mrs. Chalmers?«
»Ich besitze nicht viel; Schmuck hat mich nie {17}interessiert. Was ich habe, bewahre ich in meinem Zimmer in einer Kassette auf. Die Kassette hatte ich nach Palm Springs mitgenommen. Wir waren dort, als die goldene Dose gestohlen wurde.«
»Wie lange vermissen Sie sie jetzt?«
»Warten Sie – heute ist Dienstag. Am Donnerstag abend habe ich sie in den Safe getan. Am nächsten Morgen fuhren wir ab. Gestohlen worden muß sie sein, nachdem wir weggefahren waren, also vor vier Tagen oder weniger. Gestern abend, als wir nach Hause kamen, sah ich im Safe nach, und da war sie verschwunden.«
»Warum haben Sie gestern abend im Safe nachgesehen?«
»Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht«, fügte sie hinzu, und es klang wie eine Lüge.
»Hatten Sie irgendwie eine Ahnung, daß sie gestohlen sein könnte?«
»Nein. Bestimmt nicht.«
»Was ist mit Ihrem Diener?«
»Emilio hat sie nicht gestohlen. Für ihn kann ich bürgen – absolut.«
»Wurde außer der Dose noch etwas mitgenommen?«
Sie überlegte. »Das glaube ich nicht. Mit Ausnahme natürlich der Briefe, der berühmten Briefe.«
»Waren die Briefe wichtig?«
»Wichtig waren sie, wie ich schon sagte, für meinen Mann. Und natürlich für seine Mutter. Aber sie ist schon lange tot, seit Kriegsende. Ich bin ihr nie begegnet.« Es klang ein wenig betrübt, als hätte man ihr den mütterlichen Segen vorenthalten, was sie immer noch als Betrug empfand.
{18}»Warum hätte ein Einbrecher sie wohl...