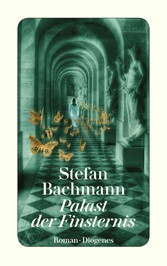Suchen und Finden
Service
Palast der Finsternis
Stefan Bachmann
Verlag Diogenes, 2017
ISBN 9783257608052 , 400 Seiten
2. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
2
Unser Treffpunkt ist am JFK-Flughafen, in der weißen Glas- und Stahlhalle von Terminal vier. Wir haben äußerst detaillierte Anweisungen erhalten:
7:45 Uhr – Ankunft am Flughafen. Nicht in die Koffer schauen. Sofort durch die Sicherheitsschleuse gehen und dann weiter zu Gate B 24. Dort Zusammentreffen mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Forschungsreise und Abflug. Begleit- und Kontaktperson ist Professor Dr. Thibault Dorf.
Hier steht es, schwarz auf weiß auf dickem Büttenpapier, enthalten in den piekfeinen blauen Mappen, die uns zugeschickt worden sind. Ich fahre mit den Fingern über das Wappen der Sapanis, das in die rechte obere Ecke geprägt ist – ein Beil und eine Flagge, umrankt von zwei Rosen. Sie finanzieren unsere Expedition. Ihnen gehört das Schloss, unter dem die archäologische Sensation entdeckt wurde. Nach Google sind sie die fünftreichste Familie der Welt, aber ich habe noch nie von ihnen gehört – zu den Gartenpartys meiner Eltern sind sie jedenfalls nicht eingeladen.
Mein Herz macht kleine Sprünge, als wir uns dem Flughafen nähern.
Ich ziehe noch weitere Unterlagen heraus und blättere sie durch. Ich habe alles schon zigmal durchgelesen, aber will beschäftigt wirken, damit der Fahrer mich nicht anspricht. Manchmal versuchen die einen unterwegs anzuquatschen, weil sie heftige Wut mit putziger Teenagermelancholie verwechseln und einen aufheitern wollen, indem sie einem von ihrem Neffen erzählen, der in den Knast gewandert ist, weil er jemanden erschossen hat. Ich reiß’ ihm den Kopf ab, wenn er mich anlabert. Aber dann schmeißt er mich raus, fährt uns ans Meer, irgend so etwas, so dass ich meinen Flug verpasse.
Meine Augen huschen über die Dokumente. Packlisten. Sicherheitshinweise. Eine Anleitung mit dem Titel Teamarbeit – Fokussiertheit, Kommunikation und Kameradschaft, die ich bisher jedes Mal beim Lesen übersprungen habe. Man muss es ja nicht übertreiben. Wo ich doch zusätzlich in wochenlangen Intensivkursen Klettern und Tauchen lernen und anschließend die Teilnahmebestätigungen an ein Büro in Manhattan schicken musste, um zu beweisen, dass ich bestanden hatte.
Ich musste ellenlange Verträge Blatt für Blatt abzeichnen, mich auf jede bekannte Krankheit testen lassen, um sicherzustellen, dass ich die Expedition nicht gefährde – das Ganze unter größter Geheimhaltung. Nur die Eltern oder Sorgeberechtigten waren eingeweiht. Und da soll ich auch noch fokussiert, kommunikativ und kameradschaftlich sein? Nichts da.
Der Wagen biegt in die Abflugzone ein. Ich klemme die blaue Mappe unter den Arm, steige aus, gehe nach hinten zum Kofferraum und hebe meinen Koffer schon heraus, noch bevor der Fahrer seine Tür ganz geöffnet hat. Dann mache ich mich so schnell davon, wie es möglich ist, ohne dass es aussieht, als wäre ich auf der Flucht. Was ich allerdings durchaus bin. Ich weiß genau, dass mir der Fahrer verdutzt hinterherstarrt.
Im Hineingehen erhasche ich einen Blick auf mein Spiegelbild in den Glasschiebetüren zum Terminal. Ich bin das, was die Leute gern als »gertenschlank« beschreiben, vor allem, wenn sie keine Ahnung haben, wie eine Gerte aussieht. Scharfkantiges Gesicht unter einem dunklen, krankenschwestermäßig kurzen Bob. Verkniffener Mund. Dunkle Ringe unter den Augen. Unter dem Häkelmantel gucken Skinny Jeans sowie spitze Hexenschnürstiefel hervor, in denen mir wahrscheinlich in ein paar Stunden die Füße höllisch weh tun werden.
Mit leisem Zischen öffnen sich die Türen und teilen mich in der Mitte. Ich betrete den Terminal. Eau de Airport empfängt mich – Kaffee, staubige Teppichböden, luxuriöse Kopfnoten von Heizungsluft und billiger Waschlotion. Passagiere schieben Berge von Gepäck vor sich her wie Strafgefangene. Sie starren mich an, blöde und fast feindselig.
Schon klar, ich hasse euch auch.
Ich durchpflüge die Menge. Sofort durch die Sicherheitsschleuse gehen und dann weiter zu Gate B 24.
Eine junge Mutter, die zwei Kinder hinter sich herzieht, rempelt mich an, und ich erwarte schon eine Entschuldigung, doch bei meinem Anblick verändert sich ihr Gesichtsausdruck: Verlegenheit – Überraschung – Angst – Widerwille – alles in wenigen Millisekunden. Meine angeborene unsympathische Wirkung auf andere muss in diesem Moment wie Rauch von mir aufsteigen. Ich wickle meinen Mantel fester um mich und gehe an ihr vorbei. Knalle Pass und Boardingpass dem Security-Typen von TSA hin. Er blättert meinen Pass durch und schaut mich misstrauisch an, als er sieht, dass fast jede Seite mit Stempeln übersät ist. Aruba, letzten Sommer. Dubai, für eine Hausarbeit über Arbeitsmigration. Tokio, Freiwilligenarbeit nach dem Erdbeben.
Er wirft einen Blick auf meinen Boardingpass und bedeutet mir, zur Seite zu treten. Na super. Wahrscheinlich hält er mich für eine Drogenkurierin.
Eine TSA-Mitarbeiterin kommt zu uns herüber. Schmetterlingsbrille, knallroter Lippenstift, blasiert: »Bitte folgen Sie mir, Ma’am.« Sagt’s und führt mich an der ganzen endlosen Schlange vor der Sicherheitsschleuse vorbei. Ich wappne mich schon gegen Deportation, Gulag, was immer sie heutzutage mit unliebsamen Personen anstellen. Stattdessen positioniert mich die TSA-Angestellte als Erste in der Reihe und lässt mich dann stehen. Die Sicherheitsleute winken mich durch.
Wie bitte? Cool!
Laptop raus, Mantel aus, breitbeinig hinstellen für den Bodyscan. Schon bin ich im Abflugbereich und quetsche mich an einem Punk vorbei, der auf die glorreiche Idee gekommen ist, mit einem Dutzend Piercings, einem Nietengürtel und Stiefeln mit Metallkappen zu reisen. Er schaut mich vorwurfsvoll an, als mache er mich für seine miesen Lebensentscheidungen verantwortlich.
Und schon bin ich im Bereich mit den Fastfood-Restaurants und Zeitschriftenläden. Als ich das letzte Mal nach Europa geflogen bin, dauerte alles viermal so lang. Damals wollte ich nach Perugia zu einem Masterkurs über Renaissanceliteratur. Zu der Zeit lernte ich gerade meine fünfte Fremdsprache. Dad konnte mich nicht zum Flughafen bringen – er wohnt die Woche über im Loft in Manhattan – und wollte, dass ich mir ein Taxi bestelle, aber Mom und Penny mussten sowieso zu einem Hautarzttermin, deswegen nahmen sie mich mit. Sie saßen vorne, und Mom kaute diesen ekligen medizinischen Kräuterkaugummi, den sie so gern mag, ein Überbleibsel ihrer Ketaminabhängigkeit in den Neunzigern. Immer wieder lehnte sie sich über die Mittelkonsole und strich Pennys Haar hinter ihr winziges halbverstümmeltes Ohr, wobei sie den erdigen Pfefferminzgeruch im ganzen Auto verbreitete. Ich hätte sie am liebsten angebrüllt, sie solle gefälligst auf die Straße achten. Später in der Abflughalle tippte Penny wie wild auf ihrem Handy herum, das Haar nach vorne gekämmt, um die Narben auf ihren Wangen zu verbergen. Mom erzählte ihr irgendetwas über Madame Pripatskys Karpaltunnelsyndrom.
Ich schämte mich jetzt dafür, dass ich gedacht hatte: Mom? Penny ist nicht mal gut in Ballett. Ich bin diejenige, die nach Italien fliegt. Rede mit mir!
Doch alles, was ich sagte, war: »Penny, bitte denk dran, Pete zu füttern.«
Ich vergöttere Penny. Dabei habe ich gar nicht das Recht dazu. Im Grunde dürfte ich ihr nicht mal zu nahe kommen, aber sie ist der einzige Mensch auf der Welt, den ich, wenn, sagen wir mal, ein Komet auf die Erde zurasen würde und ich ein Raumschiff hätte, mitnehmen würde. Als Baby hat sie mir den Spitznamen Ucki verpasst, weil sie bei »Anouk« zu viel sabbern musste. Mit vier erzählte sie mir, wenn sie mal groß wäre, wolle sie ein Seestern werden, und zwar ein blauer, und Tierärztin. Ich weiß noch, dass ich sagte, das wäre eine gute Idee, denn blaue Seesterne, die auch noch Tiere heilen könnten, seien sehr selten. Jetzt ist sie elf und will später Primaballerina beim New York City Ballet werden. Dabei kann sie kaum aufrecht gehen.
Ich weiß noch, wie Penny mir zunickte, während ihr Daumen über den Bildschirm wanderte. Und wie meine Mutter und ich aneinander vorbeistarrten. Meine Mutter ist 43, mit einer so dichten, fülligen Mähne wie Mufasa in Lion King. Und sie hat ein Wahnsinnscharisma. Sie kann Firmengesellschafter, Vizepräsidenten und den Hotdogverkäufer auf dem Bürgersteig vor ihrem Bürogebäude dazu bringen, ihr ins Nichts zu folgen. Sie wünscht, ich wäre tot.
Etwa zehn Sekunden lang standen wir so, und im Inneren bettelte ich laut schreiend darum, dass ihre Augen sich nur einen halben Zentimeter zur Seite bewegen und mich ansehen würden.
Doch das taten sie nicht. Sie fixierte einen Punkt über meine Schulter hinweg und sagte: »Nimm dich in Acht vor den italienischen Jungs.« Und dann lächelte sie ihr winziges, grimmiges Lächeln, das besagte: Geschieht dir recht.
Sie wickelte das nächste Kaugummi aus. Beugte sich nach vorn und flüsterte in Pennys Ohr, als wären sie Freundinnen oder wenigstens Mutter und Tochter. Ich beobachtete sie und hätte meine Mutter am liebsten geohrfeigt, sie an den fließenden schwarzen Kleidern gepackt und geschüttelt, bis sie geschrien hätte, bis sie mich gehasst hätte, denn wenn sie mich hassen würde, müsste sie mich wenigstens ansehen. Doch ich stand vollkommen reglos da, und meine Haut prickelte. »Hinter dem Sofa im Keller stehen drei Flaschen Champagner, falls du feiern willst, wenn du nach Hause kommst«, sagte ich.
Ich fühlte mich krank und...