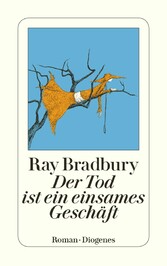Suchen und Finden
Service
Der Tod ist ein einsames Geschäft
Ray Bradbury
Verlag Diogenes, 2017
ISBN 9783257608083 , 320 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
Ich glaubte, zehn Meilen zurückzulegen, als ich hinüberrannte und dabei nur einen Gedanken hatte:
Peg!
Alle Frauen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, hatten ähnliche Berufe: Waren Bibliothekarin, {85}Lehrerin, Schriftstellerin oder Buchhändlerin. Peg vereinigte mindestens drei davon in sich, aber sie war jetzt weit weg, und das machte mir Angst.
Sie hatte den ganzen Sommer in Mexico City verbracht, um ihr Studium der spanischen Literatur zu beenden und die Sprache richtig zu lernen. Sie war zusammen mit armseligen Peonen in Zügen gefahren, in Bussen zusammen mit glücklichen Schweinen, schickte mir vor Liebe glühende Briefe aus Tamazunchale oder gelangweilte Schreiben aus Acapulco, wo die Sonne zu hell schien und die Gigolos nicht helle genug waren, wenigstens nicht für sie, die mit Henry James auf vertrautem Fuß lebte, die Voltaire und Benjamin Franklin als Ratgeberin diente. Sie hatte immer einen Picknickkorb voller Bücher bei sich.
Oft schien mir, sie würde die Brüder Goncourt als Sandwiches zum Nachmittagstee verspeisen.
Peg.
Einmal pro Woche rief sie mich von irgendwo dort unten an, aus einer kleinen oder einer großen Stadt, gerade den Mumienkatakomben von Guanajuato entstiegen oder noch außer Atem von dem Abstieg von Teotihuacán, und wir lauschten drei kurze Minuten lang dem Herzschlag des anderen und sagten einander immer wieder und wieder dieselben verliebten Dummheiten; Worte, an denen man sich nie satthört, denen man stundenlang lauschen könnte.
Jedes Mal, wenn Pegs Anruf kam, brannte die Sonne auf die Telefonzelle herab.
Jedes Mal, wenn das Gespräch zu Ende war, erstarb das Sonnenlicht, und Nebel stieg hoch. Ich wäre dann immer am liebsten in mein Zimmer zurückgerannt und hätte mir {86}die Bettdecke über den Kopf gezogen. Aber stattdessen hackte ich schlechte Gedichte aus meiner Schreibmaschine oder schrieb eine Geschichte über eine Marsfrau, die sich nach Liebe sehnt und träumt, dass ein Mann von der Erde vom Himmel fällt, sie mitnehmen will und als Belohnung für seine Mühe erschossen wird.
Peg.
Manchmal arbeiteten wir, wegen der Ebbe in meinem Geldbeutel, auch mit den alten Telefontricks.
Die Dame von der Vermittlung, die aus Mexico City anrief, fragte nach jemandem mit meinem Namen.
»Wen?«, fragte ich zurück. »Wie war der Name noch mal? Sprechen Sie bitte etwas lauter!«
In weiter Ferne konnte ich Pegs Seufzen hören. Je mehr Blödsinn ich daherredete, desto länger war ich in der Leitung.
»Moment, ich hab das noch nicht richtig verstanden.«
Die Dame wiederholte meinen Namen.
»Augenblick – ich schau nach, ob er da ist. Wer will ihn sprechen?«
Und prompt antwortete Pegs Stimme aus zweitausend Meilen Entfernung. »Sagen Sie ihm, es ist Peg! Peg!«
Dann tat ich, als ginge ich weg und kehrte kurz darauf zurück.
»Er ist nicht da. Rufen Sie in einer Stunde noch mal an.«
»In einer Stunde«, bestätigte Peg.
Dann ein Klicken und nur noch Brummen und Rauschen, sie war weg.
Peg.
Ich stürzte in die Zelle und riss den Hörer von der Gabel.
{87}»Hallo«, brüllte ich hinein.
Aber diesmal war es nicht Peg.
Schweigen.
»Wer ist da, bitte?«, fragte ich.
Schweigen. Aber da war jemand am anderen Ende der Leitung, nicht zweitausend Meilen weit weg, sondern ganz nahe. Die Verbindung war so gut, dass ich hörte, wie mein stummer Gesprächspartner durch die Nase und den Mund ein- und ausatmete.
»Wen wollen Sie sprechen?«, fragte ich.
Schweigen. Und das Geräusch des Wartens in der Leitung. Der andere musste den offenen Mund ganz dicht an die Muschel halten. Ein Wispern und Raunen drang an mein Ohr.
Meine Güte, dachte ich, seit wann rufen denn diese Telefonerotiker in Zellen an? Schließlich weiß doch niemand, dass das mein Büro ist.
Schweigen. Hechelnde Atemzüge. Stille. Atmen.
Ich schwöre, dass ein kalter Lufthauch aus dem Hörer flüsterte und mich frösteln machte.
»Nein danke«, sagte ich.
Und hängte ein.
Ich lief mit geschlossenen Augen davon und war gerade zur Hälfte über die Straße, als das Telefon wieder zu läuten begann.
Ich blieb mitten auf der Straße stehen und schaute zurück zu der Zelle, hatte Angst, den Hörer noch einmal zu berühren, noch einmal diese Atemzüge zu hören.
Doch je länger ich dastand und Gefahr lief, überfahren zu werden, desto mehr schien es mir, als hielte das Telefon {88}schlechte Nachrichten für mich bereit, als käme der Anruf aus einem Leichenschauhaus. Ich musste hingehen und den Hörer abnehmen.
»Sie ist noch am Leben«, meldete eine Stimme.
»Peg?«, schrie ich auf.
»Nur keine Panik!«, entgegnete Elmo Crumley.
Ich fiel gegen die Zellenwand und rang nach Atem, war erleichtert und zugleich wütend.
»Haben Sie eben schon mal angerufen?«, keuchte ich in den Hörer. »Woher wissen Sie, dass das mein Bürotelefon ist?«
»Jeder in der Stadt hat irgendwann schon mal mitgekriegt, wie Sie losrasen, wenn es läutet.«
»Wer ist noch am Leben?«
»Die Frau mit den Kanaris. Ich war da, gestern, spät am Abend.«
»Das war gestern Abend!«
»Deshalb ruf ich auch gar nicht an. Kommen Sie heute, so gegen Abend, bei mir vorbei! Ich hätte gute Lust, Ihnen das Fell zu gerben!«
»Wie?«
»Heute Nacht um drei, was hatten Sie da bei mir vor dem Haus zu suchen?«
»Ich?«
»Hoffentlich haben Sie ein gutes Alibi. Ich kann’s nicht haben, wenn einer versucht, mir ’n Schreck einzujagen. Gegen fünf bin ich zu Haus. Wenn Sie gleich mit der Sprache rausrücken, kriegen Sie vielleicht ein Bier. Wenn Sie nur rumstottern, tret ich Sie in den Hintern.«
»Crumley!«, schrie ich.
{89}»Kommen Sie!« Er legte auf.
Ich ging langsam zurück zu meiner Haustür.
Und wieder läutete das Telefon. Peg!
Oder der Kerl mit dem eisigen Atem?
Oder spielte Crumley mir nur einen Streich?
Ich riss die Tür auf, stürmte ins Haus, knallte die Tür hinter mir zu und spannte dann, mit entsetzlicher Geduld, ein neues unbeschriebenes Blatt Elmo Crumley in meine Underwood und zwang ihn, mir lauter nette Dinge zu sagen.
Zehntausend Tonnen Nebel ergossen sich über Venice, drängten an die Fenster meines Zimmers und drangen durch den Schlitz unter der Tür herein.
Immer, wenn in meinem Gemüt nasskalter, trüber November herrscht, weiß ich, es ist höchste Zeit, mal wieder hier von der Küste wegzukommen und mir die Haare schneiden zu lassen.
Haareschneiden hat etwas an sich, das das Blut besänftigt und Herz und Nerven beruhigt.
Außerdem hörte ich, irgendwo ganz hinten in meinem Kopf, wie der Alte aus dem Leichenschauhaus stolperte und jammerte: »Mein Gott, wer hat ihm bloß so einen furchtbaren Haarschnitt verpasst.«
Cal natürlich, der hatte ihn so übel zugerichtet. So hatte ich mehrere Gründe, ihn aufzusuchen. Cal, der schlechteste Friseur in Venice, vielleicht auf der ganzen Welt, aber billig, rief nach mir durch die wabernden Nebelschwaden, wartete mit seiner stumpfen Schere, fuchtelte mit seiner elektrischen Haarschneidehummel herum, machte arme {90}Schriftsteller und andere bedauernswerte Kunden, die in seinen Laden gerieten, sprachlos, fassungslos.
Cal, dachte ich. Schneid das Dunkel weg.
Vorne kurz, damit ich sehen kann.
An den Seiten kurz, damit ich hören kann.
Hinten kurz, damit ich fühlen kann, wie es an mir hochkriecht.
Kurz!
Aber ich kam nicht bis zu Cal, noch nicht.
Als ich hinaustrat in den Nebel, dröhnte auf der Windward Avenue eine Parade großer dunkler Elefanten vorbei. In anderen Worten, eine Parade schwarzer Lastwagen, auf denen riesige Ladekrane montiert waren. Sie donnerten dahin, hinaus zum Pier, wollten ihn niederreißen, zumindest damit beginnen. Gerüchte darüber kursierten schon seit Monaten. Und heute war es so weit. Oder spätestens morgen früh.
Ich würde noch fast den ganzen Tag abwarten müssen, ehe ich endlich zu Cal gehen konnte.
Cal war ja auch nicht gerade die größte Attraktion, die man sich vorstellen konnte.
Die Elefanten trampelten dahin und ließen das Straßenpflaster erbeben, und die Maschinen auf ihren Rücken ächzten, als sie hinauszogen, um die Geisterbahn und die Karussellpferde zu verschlingen.
Ich fühlte mich wie ein alter russischer Schriftsteller, der erfüllt ist von wahrhafter Liebe zum todbringenden Winter, zum Toben der Schneestürme; und alles, was ich tun konnte, war hinterherzulaufen.
{91}Als ich am Pier ankam, war die Hälfte der Lastwagen auf den Sandstrand hinuntergedröhnt und zog hinaus, den Fluten entgegen, um die Trümmer aufzufangen, die man über das Geländer hinabwerfen würde. Die anderen waren auf den vermodernden Planken weiter gen China gerollt, hatten dabei das nasse Holz zu Sägespänen zermahlen. Ich folgte ihnen niesend, verbrauchte ein Papiertaschentuch nach dem anderen. Mit meinem Schnupfen sollte ich besser zu Hause im Bett liegen, aber die Vorstellung, mit all meinen Nebel- und Dunst- und Regengedanken im Bett zu liegen, trieb mich weiter.
Erstaunt über meine Blindheit, blieb ich halb draußen auf dem Pier stehen und wunderte mich über all die Leute hier, die ich zwar schon oft gesehen, aber nie kennengelernt hatte. Die Hälfte der Buden war mit frischgeschnittenen Kieferbrettern vernagelt. Ein paar waren offen, warteten darauf, dass das schlechte Wetter eintreten und mit Ringen werfen oder mit Tennisbällen Milchflaschen herunterschmeißen würde. Vor einem halben Dutzend der Buden standen junge...