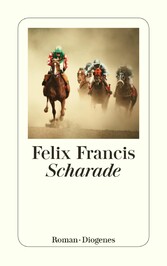Suchen und Finden
Service
Scharade
Felix Francis
Verlag Diogenes, 2017
ISBN 9783257608106 , 336 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
{7}1
»Ich habe das Testergebnis, und es ist schlecht.«
Die Worte gingen mir nicht aus dem Kopf.
Ich saß im Schatten eines Rennprogrammhäuschens am Nordeingang der Rennbahn von Cheltenham und musterte die Gesichter der Leute, die durch die Drehkreuze hereinströmten.
Rund fünfzig Personen hatten Rennbahnverbot in Großbritannien, und nach ihnen hielt ich Ausschau, aber meine Gedanken kehrten immer wieder zu dem morgendlichen Anruf meiner Schwester zurück.
»Ich habe das Testergebnis, und es ist schlecht.«
»Inwiefern?«, fragte ich bang.
»Ich habe Krebs«, sagte sie leise.
Das hatte ich befürchtet, aber trotz allem gehofft, mich zu irren.
Ich wartete schweigend. Sie würde weiterreden, wenn ihr danach war.
»Es kommt ziemlich dick.« Sie seufzte vernehmlich durch die Leitung. »Nächsten Montag OP, danach Chemotherapie.«
»Was für eine OP?«
»Die Gallenblase wird entfernt. Da sitzt der Krebs.«
»Kannst du ohne leben?«
{8}Sie lachte. »Ohne die Gallenblase oder ohne den Krebs?«
»Beides.«
»Ich hoffe es.« Das Lachen verschwand aus ihrer Stimme. »Die Zeit wird’s weisen. Im Moment sieht’s nicht so rosig aus. Ich habe vielleicht nur noch ein paar Monate.«
O Gott, dachte ich. Was tut man in so einer Situation? Macht man normal weiter, oder packt man die Zeit, die einem bleibt, so voll wie möglich? Im Endeffekt rissen wahrscheinlich die Behandlung und die Krankheit alles andere an sich. Wahrhaftig keine rosigen Aussichten.
Ich merkte, dass ich den Menschenstrom unbeachtet an mir hatte vorbeiziehen lassen.
Konzentrier dich, ermahnte ich mich und musterte wieder die Gesichter.
Es war Champion Hurdle Day, der erste Tag des jährlichen Cheltenham Steeplechasing Festivals, und trotz des ungastlichen Wetters wurden auf der Rennbahn hier in Gloucestershire mehr als fünfzigtausend Besucher erwartet. Alle hatten einen Schirm oder etwas wie ein Cape dabei – so konnten sich die wenigen Unerwünschten wunderbar in dem Gedränge verstecken.
Ich kannte alle mit Rennbahnverbot Belegten vom Sehen, aber mir ging es besonders um eine bestimmte Person, die unserem Nachrichtendienst zufolge heute in Cheltenham auftauchen könnte.
Ein dicker Mann kam zu dem Häuschen, um ein Rennprogramm zu kaufen, und kramte in seinen Taschen nach Kleingeld. Ich setzte mich anders, weil er mir die Aussicht versperrte, und schaute nun über den Kopf des direkt vor mir sitzenden Verkäufers hinweg.
{9}Für mich, Jeff Hinkley, war das Alltag. Ich arbeitete als verdeckter Ermittler für die Britische Rennsportbehörde BHA. So verbrachte ich viel Zeit damit, mehr oder weniger versteckt Gesichter zu mustern auf der Suche nach denen, die auf der Rennbahn nichts verloren hatten. Denn auch wenn ihnen der Zutritt zur Rennbahn verboten war, rein wollten sie immer.
Gallenblasenkrebs.
Wie kam meine große Schwester Faye an Gallenblasenkrebs?
Faye war zweiundvierzig, zwölf Jahre älter als ich, und hatte nach dem Tod unserer Mutter, als ich acht war, deren Rolle in meinem Leben übernommen.
Ich fragte mich, ob Krebs erblich war.
Unsere Mutter war daran gestorben, aber ich wusste nicht genau, wo der Krebs bei ihr gesessen hatte. Darüber wurde weder vor ihrem Tod noch nachher gesprochen.
Ich entdeckte ein Gesicht in der Menge.
Nick Ledder, ein Exjockey, landesweit drei Jahre Rennbahnverbot wegen des Versuchs, einen anderen Jockey zu bestechen, damit er verlor. Ich sah zu, wie er seine Eintrittskarte einscannen ließ und mit hochgeschlagenem Mantelkragen und in die Stirn gezogener Schiebermütze im eisigen Wind durchs Drehkreuz eilte. An den Augen erkannte ich ihn. Es sind immer die Augen.
Aber sein Gesicht war nicht das eigentlich Gesuchte.
Nick Ledder war ein beschränkter kleiner Gauner, der nicht nein sagen konnte, als man ihm ein paar Scheine für eine Rennabsprache anbot, und er hatte seine Dummheit teuer bezahlt. Die Funktionäre würden es sicher nicht {10}gutheißen, wenn er sich trotz Bahnverbot in Cheltenham einschlich, dabei hätte er gern möglichst bald seine Lizenz zurückbekommen.
Ich ließ ihn durch, der lief mir nicht davon, und musterte wieder die Gesichter.
Meine Gedanken drehten sich um Gallenblasen. Wozu waren sie gut, wenn man auch ohne sie leben konnte?
»Jeff, bist du da?«, fragte eine Stimme über meinen In-ear-Kopfhörer.
»Ja, bin da, Nigel«, antwortete ich über das Mikrofon an meinem linken Handgelenk.
»Tut sich was?«
»Nein«, sagte ich. »Nur Nick Ledder ist hier, den nehm ich mir aber später vor.«
»So ein blöder Hund.«
»Und bei dir?«
»Bis jetzt nichts.«
Nigel Green war ein Kollege von mir beim BHA-Sicherheitsdienst. Er stand am Südeingang. Zwei weitere BHA-Leute kontrollierten die übrigen Zugänge, doch Nigel und ich gingen davon aus, dass unsere Zielperson am ehesten den Nord- oder den Südeingang nahm, wo der Andrang am größten war – wenn er sich überhaupt blicken ließ.
Ich musterte weiter die Gesichter und bemühte mich, nicht an Gallenblasen und Chemotherapien zu denken. Wie konnte sie nur Krebs haben?
Meine Aufgabe wäre einfacher gewesen, wenn ich die Leute, die durch die Drehkreuze kamen, nicht alle gekannt hätte. Dann hätte ich nur nach einem vertrauten Gesicht Ausschau zu halten brauchen. So aber kannte ich fast jeden {11}Vierten: Pferdebesitzer, Trainer, Jockeys oder andere Stammgäste, die ich regelmäßig zu sehen bekam. Den Job beim Sicherheitsdienst hatte ich nicht zuletzt deshalb, weil ich mir unheimlich gut Gesichter merken und sie mit Namen zusammenbringen konnte.
Ich sah Duncan Johnson hereinkommen, einen Top-Hindernistrainer, und dicht hinter ihm, ganz unverhohlen, die zwanzig Jahre jüngere Frau, mit der er gerade ein Verhältnis hatte. Von Mrs Johnson keine Spur. Sie wartete derweil wohl zu Hause in Lambourn auf John Sutton, einen jungen Stallburschen aus dem Ort, mit dem sie wie meistens den Samstagnachmittag im Bett verbringen würde, um unter anderem die Rennsportübertragungen auf Kanal 4 zu genießen.
Es war erstaunlich, was man in den Kneipen von Lambourn alles herausfinden konnte, wenn man die Augen und Ohren offenhielt. Schnüffeln gehörte zu meinen Hauptaufgaben, doch ich hatte gelernt, dabei diskret und unauffällig vorzugehen, indem ich selbst kaum etwas fragte und stattdessen andere ermunterte, die Fragen für mich zu stellen.
Duncan Johnson entschwand aus meinem Gesichtsfeld, und die Stöckelschuhe der Geliebten klackten in niemand täuschendem Fünf-Schritte-Abstand auf dem Asphalt hinter ihm her.
Was für eine Galle speicherte die Gallenblase?
Im Internet hatte ich noch nicht nachsehen können, da Faye mich im Hotel angerufen hatte, als ich schon auf dem Sprung zur Rennbahn gewesen war. Ich würde das nachholen.
Der Menschenstrom lichtete sich, da das erste Rennen bevorstand und die meisten Leute zeitig gekommen waren, um {12}davor noch etwas zu essen, ein Bier zu trinken und in Ruhe ihre Wetten zu platzieren. Nur diejenigen, die vom Verkehr aufgehalten worden waren, hasteten jetzt noch durchs Drehkreuz und hielten schnurstracks auf die Wettannahme und die Tribüne zu.
»Und ab!« Die Lautsprecheransage zum Start des ersten Festivalrennens rief wie immer tosenden Beifall beim gespannten Publikum hervor.
Vielleicht war der Krebs zeitig genug entdeckt worden.
Ich wusste, dass Faye sich nach Weihnachten wegen Schmerzen im Unterleib hatte untersuchen lassen. Sie war allerdings davon ausgegangen, es seien wieder einmal Nierensteine.
Was hatte sie heute Morgen gesagt? Mir bleiben vielleicht nur noch ein paar Monate. Aber Faye nahm immer gern das Schlimmste an.
Die Zeit würde es weisen – auch das hatte sie ja gesagt.
Da ich wieder mit den Gedanken woanders war, hätte ich ihn beinah verpasst.
Gerade als das Rennen unter dem Jubel des Publikums in die rasante Schlussphase ging, rauschte die Zielperson durchs letzte Drehkreuz, als wollte sie den Einlauf noch mitbekommen. Roter Schal um Hals und Mund, verbeulter, feuchter Filzhut, tief über die Ohren gezogen. Verräterisch waren wieder die Augen.
»Volltreffer«, sagte ich ins Mikrofon. »Er ist da. Ich häng mich dran.«
Ich verließ das Programmhäuschen und wieselte mit rund zehn Metern Abstand hinter ihm her.
Er lief an den Verkaufsständen des Zeltdorfs vorbei und {13}hielt zielstrebig auf das Gedränge rechts zwischen Führring und Tribüne zu, als hätte er etwas Bestimmtes im Sinn. Vielleicht, so unsere Vermutung, war er mit jemandem verabredet, aber warum dann hier und nicht irgendwo im stillen Kämmerchen, wo es sicherer gewesen wäre?
Plötzlich blieb er stehen und drehte sich nach mir um.
Verdammt!
Ich ging, ohne zu verlangsamen, an ihm vorbei, und statt ihn anzusehen, sah ich auf das iPhone in meiner Hand.
Ich wusste, er würde mich nicht erkennen.
Ich hatte mich am Morgen in meinem Hotelzimmer ja kaum selbst im Spiegel erkannt. Meine Kollegen zogen mich zwar ständig damit auf, aber ich war überzeugt, dass es für Beschattungen am besten war, wenn der Verfolgte nicht wusste, wie ich eigentlich aussah. Deshalb verkleidete ich mich jedes Mal, färbte meinen Lockenschopf oder setzte Perücken und diverse mit Latexkleber angebrachte Gesichtsbehaarungen ein.
Eine gute Verkleidung lenkt die Leute von den Augen ab. Bot man ihnen einen anderen Blickfang, erinnerten sie sich vielleicht daran, aber nicht an die Person hinter der...