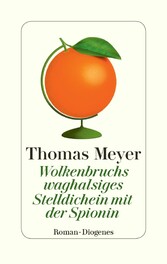Suchen und Finden
Service
Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin
Thomas Meyer
Verlag Diogenes, 2019
ISBN 9783257609851 , 272 Seiten
2. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
Mordechai schaut aus dem Fenster und fragt sich, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen solle. Elf Stockwerke unter ihm sind lauter Menschen unterwegs, zu Fuß, auf dem Rad und im Auto. Mordechai beneidet sie darum, ein Ziel zu haben. Außer der Hotelbar hat er derzeit keines. Er sucht sie jeden Abend etwas früher auf, wobei er die Schwelle zum Nachmittag gestern eindeutig unterschritten hat. Die Uhr an der Wand hat ihm das mitgeteilt. Und die Mimik der Dame, die ihm seinen Gin Tonic hingestellt hat. Und die Tatsache, dass er ihn nicht hat ordern müssen.
Das Telefon auf dem Nachttisch klingelt. Mordechai setzt sich auf die Bettkante, hebt ab und meldet sich mit dem Einzigen, was ihm von seiner Familie geblieben ist: dem Namen.
»Guten Morgen, Herr Wolkenbruch!«, grüßt ihn die Dame von der Rezeption. »Sie haben Besuch. Von Herrn Hirsch. Er wartet in der Lobby auf Sie.«
Motti – eigentlich nennen ihn alle nur so – bedankt sich und legt auf. Er kennt keinen Herrn Hirsch. Der Name klingt zwar jüdisch, sagt ihm aber nichts. Nun gibt es Leute, die hätten den Fremden an den Apparat verlangt: Woher kennen wir uns? Was wollen Sie von mir? Andere hätten ihn einfach fortschicken lassen. Aber Motti ist wohlerzogen. Wenn ihn jemand sprechen will, putzt er sich die Zähne und tritt diesem Menschen gegenüber.
Im Spiegel des Aufzugs begegnet Motti Wolkenbruch einem Motti Wolkenbruch, der nur wenig Ähnlichkeit hat mit jenem, den er bis vor kurzem kannte: Er trägt keine orthodoxe Kleidung mehr, keine Kippa und keinen Bart, sondern Jeans und T-Shirt. Außerdem hat er aufgehört, zu beten und koscher zu essen. Er isst überhaupt kaum noch. Und das alles wegen Laura.
Als er die Lobby betritt, schaut er sich links und rechts nach diesem Herrn Hirsch um. Aus einem der Ledersessel erhebt sich ein kleiner, rundlicher Herr mit Haarkranz, einer dicken eckigen Brille, wie Politiker sie früher getragen haben, und einem ebenso altmodischen beigefarbenen Polohemd, aus dessen Kragen ein goldener Davidstern herausglänzt. Motti geht auf ihn zu. Der Mann, er dürfte um die fünfzig sein, streckt Motti seine Rechte hin und sagt erfreut und mit jiddischem Akzent: »Herr Wolkenbruch! Gideon Hirsch, mein Name.«
Motti schüttelt ihm zaghaft die Hand. Ist er ein Abgesandter seiner Eltern? Soll er Motti wieder nach Hause bringen? Für eine solche Mission sieht er allerdings nicht fromm genug aus.
»Bitte«, sagt Hirsch und weist einladend auf den Sessel gegenüber seinem.
Sie setzen sich. Von irgendwoher erklingt leise klassische Musik. Hirsch studiert einen Moment lang Mottis Gesicht und fragt: »Nu, Herr Wolkenbruch, wie geht es Ihnen?«
»Gut«, lügt Motti.
Hirsch nimmt einen Schluck von seinem Mineralwasser. »Aber Sie haben den Kontakt zu Ihrer Mischpuche verloren, nicht wahr?«
Also doch, denkt Motti. Ihm wird warm in der schmalen Brust. Er stellt sich vor, wie seine Mame, während hier über seine Heimkehr verhandelt wird, eine Hühnersuppe für ihn zubereitet, mit schwingendem Löffel und wackelndem Tuches.
»Ja. Und Sie sind gekommen, um zwischen uns zu vermitteln?«, fragt Motti. Überflüssigerweise, findet er.
Doch wie Hirsch nun aufhört zu lächeln und den Kopf schüttelt, so gut das bei seiner Halslosigkeit eben geht, ahnt Motti, dass die Verhältnisse wohl anders liegen.
»Nein, Herr Wolkenbruch, leider nein«, sagt Hirsch leise. »Gäbe es in Ihrem Fall noch etwas zu vermitteln, würde Ihr Rabbiner hier sitzen. Nicht ich.«
Motti wird unruhig. Wenn dieser Mann nicht gekommen ist, um ihn mit seiner Familie zu versöhnen – wozu denn dann?
Hirsch bemerkt Mottis Irritation, hebt die Hände und sagt feierlich: »Ich bin von den Verlorenen Söhnen Israels. Und Sie, mein lieber Herr Wolkenbruch, sind nun einer von uns.«
»Die Verlorenen Söhne Israels?«, fragt Motti verwirrt.
Hirsch nickt: »Wir sind eine Gruppe von Jidn, die nicht mehr orthodox leben und deren Familien deswegen mit ihnen gebrochen haben. Wir unterstützen einander, bei der Suche nach Arbeit und einer Wohnung und so weiter. Und wir möchten auch Ihnen helfen.«
Das Wort gebrochen schmerzt Motti. Gerade aus fremdem Mund macht es ihm bewusst, wie endgültig das Geschehene ist. Aber was hat er auch erwartet? Dass seine Eltern ihn, nachdem er sich mit einem nichtjüdischen Mädchen eingelassen hat, bloß zum Spaß rauswerfen und ihre Handynummern wechseln? Es ist wahr: Man hat mit ihm gebrochen, er ist ein verlorener Sohn. Hirsch, der sich wohl einst in einer vergleichbaren Situation befunden hat, beobachtet ihn teilnahmsvoll und winkt einen Kellner herbei, damit der Mottis Getränkewunsch aufnehme. Kurz darauf werden eine halbleere Flasche und ein halbvolles Glas Orangensaft auf den Clubtisch zwischen ihren Sesseln gestellt.
Motti trinkt, als hätte man ihm die pure Hoffnung serviert, und fragt schließlich: »Aber wie haben Sie denn von meiner Geschichte erfahren? Und mich hier gefunden?«
»Nu, wenn ein frommer Jid auf einmal Jeans trägt und etwas mit einer Schickse anfängt, bleibt das nicht lange ein Geheimnis«, antwortet Hirsch. »Ich habe dann einfach ein paar Hotels angerufen und nach einem Herrn Wolkenbruch gefragt. Beim sechsten hatte ich Erfolg. Zürich ist ja zum Glück keine Millionenstadt.« Hirsch schaut Motti einen Moment lang unbestimmt an. »Von Ihrem Fall konnte man allerdings auch in der Jüdischen Zeitung lesen«, fährt er fort, greift in den abgewetzten Lederrucksack, der neben seinem Sessel steht, und reicht Motti ein Stück Zeitungspapier. Es ist eine Todesanzeige.
Mordechai Wolkenbruch, steht da.
Er ist uns verlorengegangen, steht da.
Judith und Moses Wolkenbruch mit Familie, steht da.
Motti blickt entsetzt auf.
»Ich finde es auch sehr extrem. Aber leider ist so was nicht selten«, sagt Hirsch. »Die Eltern von Benjamin Stern haben sogar – kennen Sie Benjamin Stern? Aus Berlin?«
»Nein«, antwortet Motti und denkt sich: Ständig wollen die Jidn wissen, ob man die Jidn kenne, die sie kennen.
»Seine Eltern haben für ihn sogar eine Beerdigung abgehalten, mit leerem Sarg, bloß weil er ihnen gestanden hat, dass er sich nicht für Frauen interessiere. Das müssen Sie sich mal vorstellen: Da steht ein Grabstein in Berlin, und der Mann, zu dem er gehört, läuft noch herum!« Hirsch schüttelt empört den Kopf.
»Und was macht er jetzt?«, fragt Motti.
»Jetzt ist er bei uns. Wie Sie bald!«
»Wie meinen Sie?«
»Wir fliegen jetzt nach Hause. Nach Israel.«
Motti macht ein ratloses Gesicht, wie so oft in den vergangenen Tagen und Wochen. Er muss aufpassen, dass es nicht sein normales Gesicht wird.
»Unsere Maschine geht« – Hirsch schaut auf seine Armbanduhr – »in drei Stunden.«
Nach Israel. Nach Hause. Das waren schon vorher eng verwandte Begriffe. Und nun sollen es Synonyme sein?
Motti denkt nach. Aus der Hühnersuppe der Mame wird allem Anschein nach nichts. Laura hat sich auch nicht mehr gemeldet. Offenbar hat sie keine Lust darauf, einen Mann dabei zu begleiten, sich aus der Umklammerung einer jüdischen Mutter zu befreien. Und das Hotel hat seine Ersparnisse beinahe aufgezehrt. Das Hotel und dessen Bar, um genau zu sein.
»Okay«, sagt er.
Nachdem Motti seine Tasche aus dem Zimmer geholt und dieses sowie die Getränke aus der Lobby bezahlt hat, nehmen die beiden Männer vor dem Hotel ein Taxi und lassen sich in leichtem Regen und zu lautem Radiogeschwätz zum Flughafen bringen. Motti fällt auf, dass Hirsch nicht so gut riecht. Der Wagen nimmt die Einfahrt zur Autobahn, lässt die Stadt Zürich hinter sich und hält, weil in der Schweiz alles so dicht beieinander steht wie Joghurt im Kühlschrank, nur wenige Minuten später vor dem Flughafeneingang. Motti begleicht die Fahrt. Es ist das Mindeste, was er beitragen kann, wenn man ihn schon aus seiner Lage befreit, deren Misslichkeit ihm in der vergangenen Stunde immer bewusster geworden ist.
Der Flug geht aber nicht nach Tel Aviv, wie Motti feststellt, er geht nach Paris.
»Dort haben wir vier Stunden Aufenthalt«, erklärt Hirsch. »Das Ticket war so viel günstiger. Wissen Sie, wir haben nicht viel Geld. Und müssen manchen helfen.«
Motti sieht das ein. Sie geben seine Tasche auf, passieren die Sicherheitskontrolle und spazieren zum Gate, wobei Hirsch arg ins Schnaufen gerät. An einer Bar trinken sie einen Kaffee, erneut auf Rechnung von Motti, der nun ganz mitteilsam wird und sprudelnd die Ereignisse der letzten Monate zusammenfasst: erfolglose Versuche der Mame, ihn mit einer jüdischen Frau zu verheiraten, erfolgreicher Versuch seinerseits, mit einer nichtjüdischen Frau zu schlafen, erfolgloser Versuch, es mehr als zweimal zu tun, Abbruch sämtlicher Beziehungen. Hirsch hört aufmerksam zu und fragt schließlich: »Und wie fühlen Sie sich bei all dem, Herr Wolkenbruch? Aber sagen Sie bitte nicht wieder ›gut‹.«
»Ich weiß nicht …«, antwortet Motti, »… verraten. Und ungeliebt.« Indem er seine Empfindungen ausspricht, nimmt er sie noch viel stärker wahr. Seine Augen werden feucht.
»Nu, so würde es an Ihrer Stelle jedem gehen«, sagt Hirsch nach einer taktvollen Pause. »Aber ich denke, das liegt vor allem daran, dass Sie passiv erzählen.«
»Passiv?« Wieder das ratlose Gesicht.
»Ja. Sie sagen beispielsweise: Meine Mame hat mich von zu Hause rausgeworfen.«
»Hat sie ja«, schnieft Motti.
»Nein. Das haben...