Suchen und Finden
Service
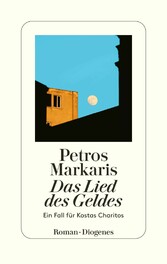
Das Lied des Geldes - Ein Fall für Kostas Charitos
Petros Markaris
Verlag Diogenes, 2021
ISBN 9783257612011 , 320 Seiten
2. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
Wir sind nicht sehr viele. Gerade mal hundert vielleicht. Als ich jung war, hätten wir vor der Partei für die misslungene Mobilisierung der Massen Rechenschaft ablegen müssen. Aber heute, da zehn Teilnehmer auf einer Straße oder einem Platz schon als Demonstration durchgehen, gelten wir als Menschenmeer.
Die meisten stammen aus unserem Obdachlosenheim. Bei einem Rundgang durch die übrigen Asyle konnte ich weitere Interessenten gewinnen. Dazu kommen einige direkt von der Straße.
Die Passanten bleiben neugierig stehen und beobachten uns. Sie fragen sich völlig zu Recht, was eine Gruppe Unbekannter, die einen Sarg mit sich führt, auf dem Attikis-Platz zu suchen hat. Genauso ergeht es den Bewohnern des Viertels, die das Schauspiel von den Fenstern und Balkonen verfolgen.
Zwei Männer, die ich nicht namentlich kenne, da sie aus einem anderen Obdachlosenasyl stammen, stellen den Sarg auf dem Boden ab.
»Hältst du eine Rede, Lambros?«, fragt mich Stelios.
»Ja, am besten warten wir noch ein bisschen. Vielleicht kommen ja noch mehr Leute.«
Doch anstelle zusätzlicher Teilnehmer trifft ein Streifenwagen ein. Die Erklärung liegt auf der Hand. Einer der Schaulustigen muss, erschrocken über den Anblick von Sarg und Trauerzug, die Polizei alarmiert haben.
»Was spielt sich hier ab?« Die Frage des Polizeibeamten, der aus dem Streifenwagen gestiegen ist, richtet sich an alle und keinen.
»Eine friedliche Kundgebung«, antwortet Anna.
»Und der Sarg? Liegt da jemand drin oder ist der leer?«
Bevor ich ihm antworten kann, ist die MAT-Sondereinheit, die »Eingreiftruppe zur Wiederherstellung der Ordnung«, im Laufschritt herbeigeeilt und hat uns eingekesselt. Meine Mitstreiter werfen mir besorgte Blicke zu.
»Im Sarg, da liegt die Linke«, erkläre ich dem Polizeibeamten. »Sie hat Selbstmord begangen, und wir wollen sie zu Grabe tragen. Die Linke ist in den Armenvierteln groß geworden. Daher haben wir beschlossen, sie hier am Ionias-Boulevard aufzubahren, wo sich Arme und Migranten immer die Türklinke in die Hand gegeben haben.«
»Den Sarg nehmen wir mit. Und ihr löst euch schön friedlich auf, denn Ausschreitungen nützen weder euch noch uns etwas«, meint der Truppführer der MAT-Sondereinheit zu mir, der meine Antwort aus nächster Nähe mitbekommen hat.
Sein Gesichtsausdruck bringt mich auf die Palme. Wenn man so alt ist wie ich, dann versetzen einen Zorngefühle zurück in die Vergangenheit.
»Können Sie mir eine Sache erklären?«, frage ich. »Wenn wir in meiner Jugend für die Linke auf die Straße gegangen sind, haben uns eure Vorgänger zuerst auf der Straße und danach in der Zentrale der Sicherheitspolizei grün und blau geschlagen. Und jetzt, da wir euch erklären, dass die Linke Selbstmord begangen hat, wollt ihr uns wieder verprügeln? Muss man für eine Unterstützung der Linken, sei sie nun tot oder lebendig, immer mit einer Prügelstrafe rechnen?«
»Herr Lambros, wieso rufen Sie nicht Kommissar Charitos an?«, sagt Stelios zu mir und reicht mir das Handy.
Der Truppführer stutzt. »Sie kennen Kommissar Charitos?«
Bevor ich ihm antworten kann, tritt der Polizeibeamte aus dem Streifenwagen auf ihn zu und flüstert ihm etwas ins Ohr.
»Ist der Enkel des Kommissars tatsächlich nach Ihnen benannt?«, will er wissen, nachdem ihn der Polizeibeamte aufgeklärt hat.
»Ja.«
Er gibt sofort klein bei. »In Ordnung, Sie können Ihre Veranstaltung durchführen. Wir bleiben am Rande und passen auf, dass nichts aus dem Ruder läuft.«
Wie war es zu der Aktion gekommen? Auf eine solche Frage würde ich spontan »Na einfach so« oder auch »Alte Sünder bekehrt man nicht« antworten. Doch das stimmt nicht. Der Einfall kam nicht aus dem Nichts.
Es waren die vielen Anfragen im Obdachlosenheim gewesen, die wir ablehnen mussten. Dabei ging es nicht um irgendwelche Anliegen unserer Bewohner, sondern um Menschen, die an unsere Tür klopften und bei uns aufgenommen werden wollten. Doch wir hatten kein Bett mehr frei und mussten sie wieder auf die Straße schicken. Wenn ich sah, wie sie stumm und mit hängenden Köpfen davonzogen, fragte ich mich, wie wir in den fünfziger oder sechziger Jahren darauf reagiert hätten.
Damals hätten wir für die Armen und Entrechteten demonstriert. Wir hätten Parolen skandiert, wären mit der Polizei aneinandergeraten und vermutlich unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen. In neun von zehn Fällen wussten wir von vornherein, dass wir einsame Rufer in der Wüste waren. Aber der Satz »Verdammt, damit kommt ihr nicht durch!« hätte uns auf die Barrikaden getrieben.
Damals stand eine Partei und linke Bewegung hinter uns, die genau wusste, wie sie uns mit diesem »Verdammt …« mobilisieren konnte. Heute ist der Satz zum Seufzer »Verdammt, was können wir schon dagegen tun?« verkommen. Die Mutlosigkeit der Obdachlosen hat mir die Augen geöffnet, und ich merkte, dass auch ich inzwischen zur Fraktion der Resignierten gehörte. Auf einmal wurde mir klar, dass wir die Linke und alles, was wir durchgemacht hatten – die Bewegung, den Widerstand im Zweiten Weltkrieg, die Verfolgung, das Exil auf den Verbannungsinseln in der Bürgerkriegszeit – vergessen mussten. Nichts davon zählte noch, stattdessen waren die Tage der Linken gezählt.
Heute müssen sich die Armen aus eigener Kraft erheben, wenn sie je wieder gute Tage sehen wollen. Von politischen Gruppierungen haben sie nichts zu erwarten, sie müssen selbst zu einer Bewegung werden. Alles andere sind nostalgische, gefühlsduselige Geschichten aus der Vergangenheit. Auch ich selbst, Lambros Sissis, musste von der Ideologie des Marxismus-Leninismus auf die Ideologie der Armut umschwenken. In der Politik agieren nurmehr Leute, die ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben.
Plötzlich sehe ich, wie ein Grüppchen Migranten zu uns stößt. Ihr Anführer, ein dreißigjähriger Grieche, tritt auf mich zu. »Als ich gesehen habe, dass ihr die Linke zu Grabe tragt, habe ich meine Nachbarn zusammengerufen. Viele kommen aus ehemaligen Ostblockländern, hatten aber keine Gelegenheit, den Sozialismus zu beerdigen, da sie der politische Wandel völlig überrascht hat. Jetzt können sie das nachholen.«
Ich werfe einen Blick auf die übrigen Demonstranten. Ruhig warten sie das Kommende ab, genauso wie die MAT-Sondereinheit, die sich aus der Sache heraushält und am Rand des Platzes strammsteht. Jetzt ist der geeignete Moment, meine Rede zu beginnen.
»Wir sind heute hier, um eine Trauerfeier zu begehen. Eine Kundgebung also, in der kein Platz ist für Geschrei und Ausschreitungen, sondern für stille Einkehr. Ich selbst habe mich mein Leben lang für die Linke und den gesellschaftlichen Wandel eingesetzt. Heute sage ich euch: Das alles ist Schnee von gestern. Ihr könnt von niemandem Unterstützung und Rückendeckung erwarten.«
»Wem sagst du das!«, erhebt sich eine Männerstimme aus der Menge. »Wir sind hier, weil der Sozialismus in unserer Heimat tot ist.«
»Auch im Sozialismus haben wir, genauso wie hier, für einen Kanten Brot gearbeitet«, entgegnet ihm eine Frau.
»Bei uns in Pakistan kein Stück Brot. Hier kein Stück Brot. Wo Stück Brot?«, ruft einer aus der zweiten Reihe und ringt verzweifelt die Hände.
»Was ihr sagt, stimmt!«, rufe ich ihnen zu. »Daher könnt ihr von keinem System, von keiner Regierung und von keiner Bewegung Rückhalt und Hilfe erwarten. Der Sozialismus und die Linke, an die wir geglaubt haben, haben Selbstmord begangen, weil sie sich auf das Spiel der Macht eingelassen haben. Die Armen auf der ganzen Welt müssen begreifen, dass nur noch sie selbst die Bewegung sind.«
»Gut gesagt, aber was können wir schon ausrichten, verdammt noch mal?«, ertönt jetzt die Stimme einer Frau, die mir die Gedanken von vorhin wohl von der Stirn abgelesen hat.
»Wir müssen uns in jedem Viertel, in jeder Wohngegend zusammentun. Nicht, um über unser Schicksal zu klagen, sondern um über unsere Probleme zu reden. Wir müssen aussprechen, wer uns ausbeutet, wer uns bestiehlt, wer von unserem Unglück profitiert. In ein paar Tagen werden wir ein Komitee zusammenstellen. Dann könnt ihr zu uns kommen, um uns eure Probleme zu schildern, und danach entscheiden wir gemeinsam, wie wir darauf reagieren und welche Form von Protest wir organisieren.«
Ich warte ab, ob sich jemand zu Wort meldet. Doch alle schweigen. Sie überlassen mir die Initiative für den nächsten Schritt.
»Dann beerdigen wir jetzt die Linke«, sage ich.
Ich lasse die Stadtbahnstation hinter mir und biege in den Ionias-Boulevard ein. Die Prozession folgt mir, mit dem Sarg direkt hinter mir.
Ich habe die Gegend zuvor ausgekundschaftet und weiß, wo wir den Sarg abstellen können: auf dem kleinen Grundstück eines Einfamilienhauses, das noch aus der Zeit um 1922 stammt, als die Verfolgten des Griechisch-Türkischen Kriegs von Kleinasien nach Athen kamen. Das Grundstück ist kahl und leer, nur ein kleiner Garten mit Bäumen umgibt das Haus der einstigen Flüchtlinge. Auch ohne die für Friedhöfe üblichen Zypressen ist dieser Ort die geeignete Grabstelle für die Linke.
»Stellt den Sarg hier ab«, sage ich zu den beiden Trägern und deute auf einen Platz in der Mitte des Grundstücks.
»Ich schlage vor, dass wir eine Schweigeminute einlegen«, sage ich zu den Teilnehmern.
»Wollen wir denn...


