Suchen und Finden
Service
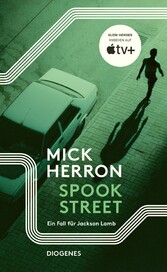
Spook Street - Ein Fall für Jackson Lamb
Mick Herron
Verlag Diogenes, 2021
ISBN 9783257612103 , 464 Seiten
2. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
Hitze steigt bekanntlich auf, aber nicht immer ohne Anstrengung. In Slough House wird ihr Aufstieg von Klackern und Gurgeln begleitet: das hörbare Tagebuch einer erzwungenen und schmerzhaften Passage durch schiefe Rohre. Wenn man das Leitungssystem aus dem Gebäude herauspräparieren und als freistehendes Exoskelett betrachten könnte, wäre es überall undicht und feucht: ein arthritischer Dinosaurier mit schiefen Gelenken, bei dem Brüche unsauber verheilt sind, die Gliedmaßen ein unstimmiges Durcheinander, fleckige und rostige Extremitäten, die kaum noch Wärme verströmen. Und der Kessel, das Herz dieses Ungetüms, würde weniger schlagen als vielmehr in einem Trip-Hop-Rhythmus flattern. Seine gelegentlichen Ausbrüche von Enthusiasmus produzieren heiße Explosionen an unwahrscheinlichen Stellen; sein unregelmäßiger Puls ist das Ergebnis von Lufteinschlüssen, die unbedingt entweichen wollen. Noch mehrere Türen weiter hört man das Rumpeln dieses antiquierten Heizungssystems, und es klingt wie das Klopfen eines Schraubenschlüssels auf ein Eisengeländer, wie eine verschlüsselte Nachricht, die von einer verschlossenen Zelle zur anderen übermittelt wird.
Es ist ein Energie verschwendendes, unbrauchbares Drecksding, aber andererseits ist dieses gesamte schäbige Bürogebäude – in der Nähe der Barbican-U-Bahn-Station, in der Aldersgate Street im Stadtteil Finsbury – auch nicht gerade für seine Effizienz bekannt, weder in puncto Ausstattung, noch was das Personal angeht. In der Tat könnten seine Bewohner genauso gut selbst mit Schraubenschlüsseln auf Rohre einhämmern, in Anbetracht ihrer Kommunikationsfähigkeiten, doch an diesem kalten Januarmorgen, zwei Tage nach dem schrecklichen Anschlag in der Westacres-Mall, der über vierzig Menschenleben gefordert hat, sind im Slough House andere Geräusche zu hören. Ausnahmsweise nicht in Jackson Lambs Zimmer: Von allen Insassen des Hauses ist er zwar derjenige, der am besten auf die marode Heizungs- und Sanitäranlage eingestimmt ist, da ihm selbst innerliches Glucksen und plötzliches warmes Rülpsen nicht fremd sind, aber im Moment ist sein Büro leer und sein Heizkörper die einzige Quelle des Lärms. Im Zimmer gegenüber – bis vor ein paar Monaten das von Catherine Standish, jetzt das von Moira Tregorian – findet zumindest eine Unterhaltung statt, wenn auch notwendigerweise einseitig, denn Moira Tregorian hat den Raum derzeit für sich allein: Ihr Monolog besteht aus einzelnen, betonten Silben – ein »Oh!« hier, ein »Nein!« dort –, durchsetzt mit dem einen oder anderen vollständigen Satz – »Was soll ich damit?«, und: »Was ist das für ein Mist?« Ein jüngerer Zuhörer würde vielleicht annehmen, dass Moira diese Fragmente in ein Telefon spricht, doch in Wirklichkeit sind sie an die Unterlagen auf ihrem Schreibtisch gerichtet, Unterlagen, die sich in Catherine Standishs Abwesenheit angesammelt haben, und zwar auf eine Art und Weise, die von organisatorischen Prinzipien, ob chronologisch, alphabetisch oder allgemein, völlig unberührt sind, da sie von Lamb dort abgelegt wurden, dessen Ordnungsfimmel notorisch unterentwickelt ist. Eine Menge Blätter, und jedes hat irgendwo seinen Platz, und herauszufinden, welcher von den vielen möglichen Orten das sein könnte, ist heute Moiras Aufgabe, ebenso wie sie es gestern war und morgen sein wird.
Selbst wenn er es absichtlich getan hätte, hätte sich Lamb kaum eine passendere Einführung in das Leben unter seinem Kommando ausdenken können, hier in dieser administrativen Besenkammer des Geheimdienstes; doch um bei der Wahrheit zu bleiben, hat Lamb die Dokumente weniger in Moiras Obhut gegeben als sie vielmehr aus seiner eigenen verbannt, aus den Augen, aus dem Sinn – seine Lösung für unerwünschten Papierkram. Moira, die erst seit zwei Tagen in Slough House arbeitet und Jackson Lamb noch nicht kennengelernt hat, hat bereits beschlossen, dass sie ein ernstes Wort mit ihm reden wird. Und während sie bei diesem Gedanken heftig nickt, knurrt der Heizkörper wie eine demente Katze, was sie so erschreckt, dass sie die Papiere, die sie in der Hand hält, fallen lässt und sie gleich hastig aufrafft, damit sie nicht wieder durcheinandergeraten.
Unterdessen dringen vom unteren Stockwerk aus andere Geräusche nach oben: ein Gemurmel aus der Küche, das Sprudeln eines Wasserkochers und das Brummen eines geöffneten Kühlschranks. In der Küche stehen River Cartwright und Louisa Guy, beide mit einer Tasse heißen Tees in der Hand, und Louisa hält einen Monolog über die Irrungen und Wirrungen, die mit dem Kauf ihrer neuen Wohnung einhergehen. Sie liegt ziemlich weit außerhalb, wie es erschwingliche Londoner Wohnungen zu tun pflegen, aber ihre Beschreibung von der Größe, dem Komfort und der Aufgeräumtheit zeugt von einer neuen Zufriedenheit, über die River sich aufrichtig freuen würde, wenn er nicht andere Sorgen im Kopf hätte. Dabei knarrt die ganze Zeit über hinter ihm die Tür zu seinem Büro an einem quietschenden Scharnier, nicht weil sie gerade jemand benutzt, sondern ganz allgemein aus Protest über die lästige Zugluft überall in Slough House und im Spezielleren wegen des Aufruhrs ein Stockwerk weiter unten.
Doch auch wenn seine Tür unbenutzt bleibt, ist Rivers Büro nicht leer, denn sein neuer Kollege – seit etwa zwei Monaten ein Slow Horse – sitzt darin, zusammengesunken in seinem Stuhl, die Kapuze seines Hoodies über den Kopf gezogen. Abgesehen von seinen Fingern ist er vollkommen reglos, aber diese bewegen sich unaufhörlich. Die Tastatur ist zur Seite geschoben, und während ein Beobachter nichts weiter als einen fortgeschrittenen Fall von Zappeligkeit sehen würde, ist das, was J.K. Coe auf der abgewetzten Oberfläche seines Schreibtisches trommelt, eine stumme Nachahmung der Musik auf seinem iPod: Keith Jarretts improvisiertes Klavierstück bei dem Konzert in Osaka am 8. November 1976, einem der Sun-Bear-Konzerte. Coes Finger mimen die Melodien, die Jarrett an diesem Abend Tausende Kilometer weit weg vor vielen Jahren entdeckte; ein tonloses Echo des Genies eines anderen Mannes, und es dient einem doppelten Zweck: Coes düstere Gedanken zu vertreiben und die Geräusche zu übertönen, die ihm sein Kopf ansonsten vorgaukeln würde: das Geräusch von blutigem Fleisch, das zu Boden fällt, zum Beispiel, oder das Summen eines elektrischen Tranchiermessers, das von einem nackten Eindringling geschwungen wird. Aber all das behält er für sich, und was River und die anderen Insassen von Slough House angeht, betrachten sie J.K. Coe als ein Rätsel, ein in ein Geheimnis gehülltes Enigma in der Verpackung eines mürrischen, unkommunikativen Trottels.
Doch selbst wenn er jodeln würde, könnte man ihn bei dem Lärm in der Etage darunter nicht hören. Wobei der Krach nicht aus Roderick Hos Zimmer kommt. Von dort hört man nicht mehr als sonst – das Summen der Computer, das Tinnitus-Scheppern aus Hos iPod, der aggressivere Musik enthält als der von Coe, sein nasales Pfeifen, dessen er sich nicht bewusst ist, das gummiartige Quietschen seines Drehstuhls, wenn er sein Gesäß bewegt. Doch das eigentlich Überraschende an der Atmosphäre in Hos Zimmer ist – überraschend für jeden, der sich dort aufhielte, was niemand tut, weil es Hos Zimmer ist –, dass sie optimistisch ist. Fröhlich sogar. Als würde noch irgendetwas anderes als sein Überlegenheitsgefühl in diesen Tagen Roddy Hos Herz erwärmen, was praktisch wäre, wenn man bedenkt, dass sein Heizkörper nicht in der Lage ist, irgendetwas zu erwärmen, weder Herz noch sonst was: Er hustet jetzt, spuckt zischend aus seinem Ventil und spritzt Wasser auf den Teppich. Ho bemerkt es nicht, und er registriert auch nicht das darauffolgende Glucksen aus dem Leitungssystem – ein Geräusch, das Pferde, Löwen, Tiger aufscheuchen würde –, was jedoch weniger daran liegt, dass Ho ein übernatürlich cooler Typ wäre (wie immer er auch selbst darüber denkt), sondern dass er es einfach nicht hören kann. Was wiederum daran liegt, dass das Plätschern und Gluckern im Inneren des Heizkörpers, das Klopfen und Klicken der Rohre, das plätschernde Rasseln des Leitungsexoskeletts von den Geräuschen nebenan übertönt wird, wo Marcus Longridge Shirley Dander waterboardet.
»Würg-blörgh-argh-hust-blärgh!«
»Hab kein Wort verstanden.«
»Blearrrgh!«
»Entschuldige, heißt das …«
»BLARGH!«
»… Onkel?«
Der Stuhl, an den Shirley mit Gürteln und Tüchern gefesselt war, stand schräg an ihren Schreibtisch gelehnt und krachte beinahe zu Boden, als sie den Rücken durchbog. Ein lautes Knacken deutete auf einen ernsthaften Schaden hin. Im selben Moment klatschte der Waschlappen, der ihr Gesicht bedeckt hatte, auf den Teppich wie ein totes Meerestier auf einen Felsen. Shirley gab eine Weile lang ähnliche Geräusche von sich; wenn man hätte raten sollen, hätte man vermuten können, dass jemand versuchte, sich von innen nach außen zu wenden, ohne Werkzeug zu benutzen.
Marcus stellte leise pfeifend die Kanne auf den Aktenschrank. Etwas Wasser war auf seinen blassblauen Merino-pullover mit V-Ausschnitt gespritzt, und er versuchte, es wegzuwischen, mit dem üblichen Erfolg in solchen Fällen. Dann setzte er sich und starrte auf seinen Monitor, der schon längst auf Bildschirmschoner umgeschaltet hatte: ein schwarzer Hintergrund,...


