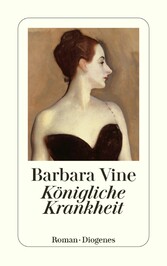Suchen und Finden
Service
Königliche Krankheit
Barbara Vine
Verlag Diogenes, 2012
ISBN 9783257601251 , 592 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[5] 1
Blut soll mein Thema sein, soviel steht fest, obgleich ich mit der Niederschrift noch nicht begonnen habe. Blut in metaphysischem Sinne als Bewahrer eines ererbten Titels, Blut als Übermittler von Erbkrankheiten, wir würden heute von Genen sprechen, im neunzehnten Jahrhundert aber, in dem Henry Nanther geboren wurde, aufwuchs und eine gewisse Berühmtheit erlangte, sprach man vom Blut. Gutes Blut, schlechtes Blut, blaues Blut, es macht böses Blut, kalten Blutes, jemanden bis aufs Blut quälen, Blut ist dicker als Wasser, Blutgeld, Blutsverwandte, Fleisch und Blut, mit Blut geschrieben – die Liste der Redensarten ist endlos. Wie viele mögen wohl auf meinen Urgroßvater passen?
Ob ich ihn gemocht hätte, weiß ich nicht recht, bislang aber habe ich als Gegenstand der Lebensbeschreibungen, die ich verfasse, Personen gewählt, die mir sympathisch waren oder denen ich Achtung und Bewunderung entgegenbrachte. Vielleicht genügt es in seinem Fall, daß er mich interessiert. Und das tut er allemal. Nur weil ich in Erfahrung gebracht habe, daß er neun Jahre lang eine Geliebte hatte und nach dem Tod seiner Verlobten deren Schwester heiratete (der er, nebenbei bemerkt, den schon für die Ältere erstandenen Verlobungsring ansteckte), habe ich mich überhaupt entschlossen, seine Biographie zu schreiben.
Natürlich wußte ich – wir alle wußten es –, daß er ein [6] bedeutender Mediziner, ja eine Koryphäe auf dem Gebiet der Blutkrankheiten und Leibarzt von Königin Victoria war. Ich wußte, daß Victoria ihm in Anerkennung seiner Dienste die Peerswürde verliehen hatte, die ich geerbt habe, und daß er 1896 ins Oberhaus kam. Ich wußte, daß er sechs Kinder hatte, von denen eins der Vater meines Vaters war, und daß er 1909 gestorben ist. Aber auch wenn er zu seiner Zeit berühmt war, mit Darwin verkehrte und unter anderem T. H. Huxley und Sir Joseph Bazalgette ihn in Briefen als ihren Freund bezeichneten, auch wenn er der erste Arzt war, der jemals zum Peer ernannt wurde – der große Chirurg Joseph Lister erhielt die Peerswürde erst ein Jahr nach ihm –, war er als Gegenstand einer Biographie für mich immer zweite Wahl, ich behielt ihn gewissermaßen in Reserve. Mein Wunschkandidat war Lorenzo da Ponte, Mozarts Librettist, denn der hatte eine wirklich fesselnde Lebensgeschichte: aus dem Priesteramt ausgestoßen, politischer Dissident, Schürzenjäger, Spezereiwarenhändler, Schnapsbrenner und Musikprofessor an der Columbia University. Bei so einem Buch wären Reisen nach Italien und vielleicht nach Wien für mich herausgesprungen, aber zu meinem Leidwesen mußte ich dieses Projekt fallenlassen, weil ich mich in Musik nicht hinreichend auskannte.
Dann kam der Brief meiner Schwester. Unsere Mutter ist letztes Jahr gestorben, und Sarah hatte die Aufgabe übernommen – so was bleibt immer an den Frauen hängen, sagt meine Frau –, die persönliche Habe zu sichten, wegzuschenken oder aufzuheben. Dabei fand sie einen Brief unserer Großtante Clara an unseren Urgroßvater. Sarah meinte, er würde mich interessieren. »Wenn der Mensch, der die [7] Hochzeit des Figaro verfaßt hat, für Dich nicht in Frage kommt«, schrieb Sarah in ihrem Begleitbrief, »könntest Du doch Urgroßvater nehmen!«
Ich hatte noch nie einen von Claras Briefen zu sehen bekommen, aber ich habe das Gefühl, daß sie eine fleißige Briefschreiberin war. Vermutlich hat meine Mutter, als sie damals, wie jetzt Sarah (so was bleibt immer an den Frauen hängen) die Habe ihres Schwiegervaters sichtete, der sich zum Sterben von Venedig nach England aufgemacht hatte, den Brief gefunden und ihn nur versehentlich nicht weggeworfen.
Ein gewisses Unbehagen, leise Unruhe und gleichzeitig ein wenig Erregung überkommen mich, wenn ich sehe, daß Clara, die vierte und jüngste Tochter, von ihrem Vater nicht als »Vater« oder »Dad« oder »Papa« spricht, sondern von »Henry Nanther«. Sonderbar, nicht? Da äußert sich diese alte Jungfer, um den Ausdruck meines Vaters zu gebrauchen, die – nur mäßig gebildet – in London ein zurückgezogenes Leben führte, nie selbst zu arbeiten brauchte und mit neunundneunzig Jahren starb, an den Bruder über den gemeinsamen Vater in einem Ton, als sei er ein nicht einmal besonders sympathischer flüchtiger Bekannter. Ihr Brief ist Anfang 1966 datiert und muß nach Venedig gegangen sein. Sie schreibt:
Du sprichst immer von Henry Nanther, als wäre er – ganz im Gegensatz zu Dir, wie Du es ausdrückst – eine Stütze der Gesellschaft gewesen, eine hochmoralische Institution und dergleichen. Ich weiß, daß Du ihn so wenig leiden konntest wie wir anderen – mit Ausnahme des [8] armen George. Wenn er ein mehr oder weniger abwesender Vater und eine ferne, einigermaßen furchteinflößende Figur in unserem Hauswesen war, so war das, wie Du vermutlich einwenden wirst, damals normal. Aber wußtest Du, daß er sich jahrelang eine Geliebte in einem Haus in Primrose Hill hielt? Und daß er ursprünglich mit Mutters Schwester Eleanor verlobt war, der, die in der Eisenbahn ermordet wurde? Von der Sache in der Eisenbahn wußten wir alle, aber weder Mutter noch Henry Nanther hat jemals erzählt, daß er eigentlich mit Eleanor verlobt war und sich erst nach ihrem Tod Mutter zuwandte. Sie werden ihre Gründe gehabt haben, warum sie nie etwas davon haben verlauten lassen; vor allem er. Darüber hinaus hat sich Henry Nanther noch ganz andere ungeheuerliche und grauenvolle Dinge geleistet, die ich aber nicht in einem Brief abhandeln mag. Wenn es Dich interessiert, können wir bei deiner Rückkehr im August in aller Ruhe darüber reden. Aber eins sage ich Dir, mein lieber alter Alex, Du wirst Deinen Ohren nicht trauen…
Ob es wohl noch zu einem Gespräch unter vier Augen gekommen ist? Ob mein Großvater je erfahren hat, was es mit diesen grauenvollen Dingen auf sich hatte? Zumindest hat er sein Wissen nicht an meinen Vater weitergegeben oder mein Vater nicht an mich. Jedenfalls lag Alexander bei seiner Rückkehr bereits im Sterben, und im Juni war er tot.
Dieser Brief aber ließ mir keine Ruhe mehr. Sarah hatte recht. Seit damals sammle ich alles, was mit Henry Nanther zu tun hat. Zum Glück scheint Henry darauf spekuliert zu haben, daß jemand seine Lebensgeschichte schreiben würde, [9] und hat der Nachwelt alles an Tagebüchern, Briefen und Büchern hinterlassen, was er für zweckdienlich hielt. Allerdings hat er nichts aufbewahrt, was sein Bild als Ausbund an Tugend hätte trüben können. Und folglich gibt es in dem ganzen Wust keine einzige Seite, kein Foto, keine Tagebuchnotiz, die einen Hinweis darauf liefern könnte, was Clara gemeint hat.
Ich bin allein. Das Haus ist leer, wie immer an Wochentagen um diese Zeit. Jude ist noch in Fulham, wo sie in einem Verlag arbeitet, und Lorraine, unsere Putzfrau, ist vor einer Stunde gegangen. Ich sitze mit meinen Unterlagen in meinem Arbeitszimmer am Alma Square, an unserem früheren Eßtisch, einem großen schweren Möbel aus Mahagoni, einen Meter achtzig lang und etwas über einen Meter breit. Die Platte verunzieren graue Flecken und schwarze Kringel, die davon zeugen, daß Jude und ich in der irrigen Annahme, der andere habe vor dem Tischdecken die Filzuntersetzer hingelegt, dort heiße Teller abgestellt haben. Wie die meisten unserer Bekannten verzichten wir inzwischen auf große Abendeinladungen, deshalb habe ich mir den Eßzimmertisch »unter den Nagel gerissen«, wie Lorraine es ausdrückt, und hierhergeholt.
Schreibtische sind nie groß genug. Schreibtische sind für Führungskräfte mit Büros und Sekretärinnen gedacht. Auf meinem Eßtisch hingegen befinden sich außer Computer und Drucker das Shorter Oxford Dictionary und Roget’s Thesaurus, ein Stapel (mehr oder weniger unbrauchbare) Ausdrucke aus medizinischen Internet-Websites, mehrere Gebirgszüge aus fotokopierten Exzerpten medizinischer [10] Fachbücher, medizinische Fachbücher selbst, A Treasury of Human Inheritance von Bulloch and Fildes, Henrys Kladde, drei Aktenboxen mit seiner Korrespondenz, drei Bücher aus der London Library, die ich, wie ich gerade sehe, heute zurückbringen muß, und ein von mir verfertigter ziemlich unzulänglicher Stammbaum, der zahlreiche Lücken aufweist. Meine eigene Linie, die mit meinem Großvater Alexander beginnt und vorläufig mit meinem Sohn Paul endet, ist sorgfältig und genau ausgeführt. George, der kleine Bruder meines Großvaters, der mit elf gestorben ist, findet sich dort, ebenso seine vier Schwestern, Elizabeth, Mary, Helena und Clara, aber die Namen der Ehemänner, Kinder und sicher auch Enkelkinder kenne ich noch nicht, nach denen muß ich in den Archiven forschen.
Zu alldem kommen die 52 ledergebundenen Tagebücher in verschiedenen Farben, Ausführungen und Größen, die Henry von seinem einundzwanzigsten Lebensjahr bis ein Jahr vor seinem Tod geführt hat, seine Bücher, Fotoalben und etliche lose Fotos. Auch Briefe über ihn und Briefe, in denen er erwähnt wird, liegen auf dem Tisch.
Blut war seine Passion. Warum? Er schrieb Bücher darüber und unveröffentlichte kleine Aufsätze, eigentümliche Betrachtungen, die vermutlich zu seinen Lebzeiten kein Mensch zu Gesicht bekommen hat. Sie stehen in einem Notizbuch, einer Kladde, die einen Einband aus schwarz marmorierter Seide hat. Eine dieser Betrachtungen – ich habe sie hier, sie liegt obenauf in der roten Aktenbox, ist aber wie die anderen undatiert – fängt so an:
[11] Ich habe mich oft gefragt, warum es ausgerechnet rot ist, und habe die Frage auch anderen gestellt. Eine der Antworten, die man mir gab, lautete: Weil Gott es so geschaffen hat....