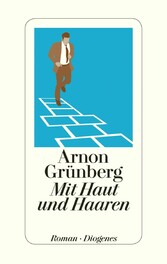Suchen und Finden
Service
Mit Haut und Haaren
Arnon Grünberg
Verlag Diogenes, 2012
ISBN 9783257601466 , 688 Seiten
2. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[11] 1
»Worauf wartest du noch?«, fragt Lea.
Sie trägt einen schwarzen Wollmantel mit Pelzkragen, aus dem Secondhand-Laden. Einen neuen könnte sie sich in dieser Preisklasse nicht leisten.
Lea reist mit leichtem Gepäck. Ein Rucksack genügt für fünf Tage. Mit einem Föhn bekommt man die meisten Knitterfalten aus der Kleidung wieder heraus.
Auf ihrem Knie liegt eine Hand. Doch eine Hand auf dem Knie ist noch keine Intimität.
»Wovon sind Sie noch mal Kennerin?«, hatte ein Professor am Abend sie beim Abschiedsumtrunk gefragt, während er die Hand wie nebenbei auf ihren Oberarm legte. Ihr war es unangenehm gewesen. Sowohl seine Frage als auch die Berührung.
Keine Stunde zuvor hatte sie im Badezimmer ihr Kleid über die Dusche gehängt und es mit dem Föhn bearbeitet. Die Knitterfalten gingen schwerer raus als gedacht. Doch morgen Vormittag fliegt sie nach Hause, dann kann sie das Kleid dampfbügeln lassen.
›Kenner‹. Ein alberner Ausdruck. Eigentlich kann man ihn nur in der Verneinung benutzen, wie zum Beispiel in: »Ich bin kein Kenner chinesischer Vasen.«
Sie ist Spezialistin für Rudolf Höß, das könnte man sagen. »Höß«, hatte sie darum erwidert und sich dann mit [12] den Worten entschuldigt: »Ich muss kurz nachsehen, ob ein paar Bekannte von mir noch da sind.«
In einer Ecke, eingeklemmt zwischen einem Pfeiler und einem gestikulierenden Herrn mit Bart, hatte sie Roland Oberstein entdeckt. Am liebsten wäre sie direkt auf ihn zugegangen, um ihn anzuflehen: »Rette mich.«
Pathetisch natürlich. Doch ist die Hoffnung, gerettet zu werden, nicht immer pathetisch? Wie aber ohne die Hoffnung auskommen? Und wenn wir schon Rettung suchen: Sollten wir uns dabei nicht lieber nur auf uns selbst verlassen? Sie weigert sich, dies als Leitsatz zu akzeptieren.
Der Professor war ihr gefolgt. »Höß«, hatte er gesagt, »der Kommandant von Auschwitz. Spannendes Thema. Hatte er nicht ein Verhältnis mit einer Lagerinsassin? Nach dem Krieg haben die Polen ihn aufgehängt, nicht wahr?« Daraufhin hatte der Professor Lea an eine Wand manövriert und ihr einen Vortrag über die Nürnberger Prozesse gehalten. Er habe dazu einen großen Artikel verfasst, und außerdem – hatte er übergangslos hinzugefügt – leide er an einer Glutenallergie und backe sich darum jeden Morgen zum Frühstück Pfannkuchen aus Buchweizenmehl.
Leas Zimmer ist auf einer Nichtraucheretage, trotzdem stinkt es darin nach Rauch. Unmittelbar nach der Ankunft hatte sie die Rezeption angerufen und um ein zusätzliches Handtuch gebeten. Sie sucht Gesellschaft, schon lange. Hier in dieser Stadt, wo sie schon zweimal gewesen ist, soll es endlich so weit sein. Wenn nicht jetzt, wann dann? So viele Konferenzen besucht sie nun auch wieder nicht. Außerdem mag Lea große Handtücher. Wenn sie schon kein Badetuch bekommen kann, möchte sie wenigstens zwei kleine.
[13] Die Rezeptionistin hatte Leas Deutsch nicht verstanden. Daraufhin hatte Lea ihre Bitte auf Englisch wiederholt, aber auch damit hatte die Rezeptionistin offenbar Schwierigkeiten. »Sie haben doch schon eins«, hatte sie in gebrochenem Englisch geantwortet. »Es sind doch Handtücher auf Ihrem Zimmer?« Sie hatte argwöhnisch geklungen. Der Gast als Handtuchdieb.
Lea hat langes, kräftiges braunes Haar. Ab und zu entfernt sie ein graues mit einer Nagelschere. Ansonsten wirkt sie eher zerbrechlich. Man sagt ihr oft, sie habe einen traurigen Blick, obwohl sie das selbst gar nicht findet. Andere wiederum meinen, sie sei ein Genie. Vielleicht müssen Genies unglücklich dreinschauen.
Trotzdem würde sie gern anders wirken. Wenigstens nicht so, dass Leute sofort denken: Mein Gott, was ist die Frau schwermütig. Seit kurzem schluckt sie Tabletten gegen die Schwermut. Es gibt Nachmittage, an denen sie vom Schreibtisch aufsteht, um sich einen Kaffee zu kochen, dann in die Küche geht und plötzlich denkt: Ich schaue nicht bloß unglücklich drein, ich bin es.
Sie würde gern frivoler, leichtsinniger wirken. Sie hofft, dass die Tabletten sie unbeschwerter machen, ihr ein gewinnenderes Wesen verleihen.
»Worauf wartest du noch?«, fragt sie nun zum zweiten Mal, nachdem sie die Hand auf das Knie ihres Besitzers zurückgelegt hat. Eine Hand, die auf ihrem Knie herumliegt wie schwitzender Käse auf einer Käseplatte, kann sie nicht brauchen.
Sie sitzt in der Bar des NH Hotels Frankfurt City, die gleichzeitig auch als Restaurant und Frühstücksraum dient [14] und sie an eine Betriebskantine erinnert, obwohl sie noch nie in einer gewesen ist.
Lea hat eine Schwäche für arische Typen: blond, helle Haut. Nur ab und zu hat sie eine Ausnahme gemacht. Roland Oberstein sieht ziemlich arisch aus. Blondes Haar, helle Haut, blaue Augen. Trotzdem kann das nicht der einzige Grund sein, warum er solch eine Anziehungskraft auf sie ausübt. Für Verlangen braucht es mehr.
Beim Willkommensdiner für die Konferenzteilnehmer und ihre Begleitung in ebendiesem Raum kam sie mit ihm ins Gespräch. Die meisten Teilnehmer hatten tatsächlich Begleitung mitgebracht. Eine etwas ältere, leicht ungepflegt wirkende Dame war mit ihren zwei Enkeln gekommen. Die Frau sollte einen Vortrag über Moral und Gedächtnis halten.
Roland Oberstein antwortet immer noch nicht. Allmählich macht sein Schweigen sie kribbelig.
Plötzlich klingelt ihr Handy. Sie steht auf und entfernt sich von dem Tisch, an dem sie und Oberstein sich vor gut einer halben Stunde niedergelassen haben, nachdem sie gemeinsam von der Abschiedsparty geflüchtet waren.
Erst neben dem Frühstücksbuffet, das schon teilweise aufgebaut ist – Marmelade, Honig und Nusscreme liegen in kleinen Portionspackungen in einem Korb –, nimmt sie das Gespräch an.
Die Hotelbar ist leer. Es ist kalt, darum hat sie den Mantel anbehalten. Obwohl man ihr versichert hatte, das Hotel liege im Zentrum der Stadt, fühlt sie sich wie mitten in einem Industriegebiet.
»Außerdem ist das Hotel in der Nähe des Flughafens«, [15] hatte jemand von der Organisation ihr gemailt. »Die meisten anderen Konferenzteilnehmer wohnen auch dort.«
»Das Hotel sieht so ausgestorben und deprimierend aus«, hatte Lea zurückgemailt, nachdem sie es im Internet begutachtet hatte. »Ich mag keine deprimierenden Hotels. Auch wenn sie in der Nähe des Flughafens liegen.«
Es hatte nichts genutzt. Trotz ihrer Einwände hatte man sie in dem deprimierenden Hotel untergebracht.
In der Essensschlange am Buffet, bei den Vorspeisen, hatte Oberstein am ersten Abend unvermittelt das Wort an sie gerichtet: »Ich hasse Buffets, das Phänomen an sich«, hatte er gesagt. »Was sie einem auch vorsetzen, immer erinnert es an eine Armenspeisung. Warum können sie uns nicht am Tisch bedienen?«
»Haben Sie Erfahrung mit Armenspeisungen?«, hatte sie gefragt.
»Nein, und ich bin auch nicht erpicht darauf. Bis man vorn angekommen ist, ist das Beste längst weg. Aber vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen: Roland Oberstein, aus den Niederlanden, aber ich unterrichte in den USA, in Fairfax. Mein Spezialgebiet, unter anderem, ist Adam Smith. Das hier ist ein Kollege von mir aus der Schweiz, Sven Durano. Wir sind die Wirtschaftswissenschaftler auf dieser Veranstaltung.«
Adam Smith. Sie konnte sich nicht erinnern, während des Studiums mal einen Text von ihm gelesen zu haben.
Am anderen Ende hört Lea ein Rauschen, aber keine Stimme. »Hallo«, sagt sie. »Hallo?«
Unknown number stand auf dem Display. Darum hat sie abgenommen. Es könnte etwas Dringendes sein.
[16] Endlich kann sie etwas verstehen. Eine Stimme: »Hier Anca.«
Anca. Die Babysitterin. Sie ist neu und kommt aus Rumänien. Man braucht mindestens vier, weil immer drei nicht können. Sie sind krank, haben Prüfung, ihre Tante ist gestorben, oder alles auf einmal. Lea sieht Anca vor sich. Spitzes Gesicht, glattes blondes Haar, abgetragene Jeans, breiter Gürtel, enger Pullover, der ihre ohnehin beachtlichen Brüste noch hervortreten lässt.
Lea stützt sich am Frühstücksbuffet ab und versucht, sich auf Ancas Geschichte zu konzentrieren.
Leas Tochter hat Nasenbluten. Ava heißt sie, nach Ava Gardner. Leas Großvater hat ein Faible für Ava Gardner. Hatte, sollte sie vielleicht sagen, denn er ist dement. Es geht ihm immer schlechter. Wahrscheinlich hat er schon lange vergessen, wer Ava Gardner überhaupt ist.
»Alles voller Blut«, sagt die Babysitterin in ihrem gebrochenen Englisch. »Auch ich.« Es klingt, als finde sie Letzteres am schlimmsten.
»Leg Ava den Kopf in den Nacken. Dann hört es von allein wieder auf. Sie hat das öfter. Es ist nicht gefährlich.«
»Nein«, sagt Anca, »man darf Kopf nicht nach hinten legen, dann verstopft. Muss Nase zudrücken. Es kommt aus linke Nasenloch. Ich drücke schon zwanzig Minuten, aber hört nicht auf. Darum ich telefoniere.«
Will eine rumänische Babysitterin ihr erklären, wie man Nasenbluten behandelt?
»Wie meinst du das, es hört nicht auf?«
»Fängt immer wieder an«, sagt Anca. Lea fragt sich, ob [17] Anca so verzweifelt klingt, weil sie kein Blut sehen kann oder weil sie ihrem Job einfach nicht gewachsen ist.
»Wo sind die Kinder jetzt?«, will sie wissen.
»Sie sitzen vor Fernsehen.«
Lea will das Gespräch beenden. Sie hat nicht vor, um diese Uhrzeit an einem Sonntagabend eine Diskussion über Nasenbluten zu führen. Daheim in Brooklyn geht sie mit ihren Kindern manchmal in den Prospect Park ganz in...