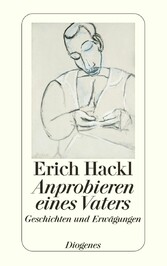Suchen und Finden
Service
Anprobieren eines Vaters
Erich Hackl
Verlag Diogenes, 2012
ISBN 9783257602364 , 304 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[9] Anprobieren eines Vaters; zugleich etwas
über Kindheit
Was zu erzählen ist von meinem Namensvetter Ferdinand Hackl, ist eine Kindheitsgeschichte und fängt an im September sechzehn oder siebzehn, am letzten heißen Tag des Jahres, im Bahnhof von Mährisch-Schönberg. Dort wird ein siebzehnjähriges Mädchen ins Abteil geschubst, von seiner Mutter, eventuell auch den Geschwistern, nur der Vater ist vermutlich nicht dabei, weil er in der Weberei schuftet oder weil er dem Bauern beim Rübengraben aushilft oder einfach nur, weil ihm gar nicht in den Sinn kommt, seiner Tochter Lebewohl zu sagen. Das Mädchen, es heißt Anna Pospischil, fährt zum ersten Mal mit dem Zug, und gleich so weit!
Aber eigentlich beginnt die Geschichte schon eine Woche früher in Frankstadt, ein paar Kilometer abseits, im Fleischerladen, den Annas Mutter betritt. Der Sohn des Fleischerehepaares, der in Wien studiert, Jus vielleicht oder Medizin, hat die Ferien zu Hause verbracht, sich anstaunen lassen oder im Geschäft mit angepackt, jetzt hockt er im Wirtshaus und liest Frontberichte. Die Anna sucht sich einen Posten in Wien, sagt die Mutter, und ob sie vielleicht mit dem jungen Herrn mitfahren darf, weil sie sich nicht auskennt, und umsteigen muß sie auch. Aber ja, sagt die Frau des Fleischers, wenn’s weiter nichts ist.
Dann sitzt der Herr Studiosus also dem Mädchen [10] gegenüber. Draußen fliegen die Äcker vorbei, die Telegraphendrähte ziehen Wellen, neben Bahnwärterhäuschen winken Kinder. Drinnen dem Fleischersohn wird zunehmend unbehaglich, denn er geniert sich wegen des verschreckten oder aufdringlich neugierigen Mädchens, seiner ärmlichen Kleidung, des lächerlichen Strohhuts, den es auch im Sitzen nicht abnimmt. Eine richtige Landpomeranze, mit der will er von seinen Freunden nicht gesehen werden. Also steht er auf, hebt seinen Koffer aus dem Gepäcknetz und übersiedelt in das Nebenabteil. Du bleib da! sagt er zu Anna.
Im Nordbahnhof wartet schon die Tante. Eine weitschichtige Verwandte der Familie ist Pflegerin in der Anstalt für Geisteskranke am Steinhof. Mit der hatte die Tante gesprochen, ob sie das Mädchen nicht unterbringen könne. Es sei arbeitswillig und gesund. Ich werde schauen, was sich machen läßt, hatte die Frau gesagt. Jetzt, wo es dasteht, in diesem unmöglichen Aufzug, erschrickt die Pflegerin. Dreh dich einmal um, sagt sie, mach ein paar Schritte. Sie schüttelt den Kopf, aber so, daß es das Mädchen gerade noch sieht. Na ja, Hilfsschwester kannst du unter Umständen werden. Nur sag keinem, daß du mit mir verwandt bist.
Anna nickt, lächelt, auch wenn ihr zum Weinen ist. Sie kommt in den Pavillon mit den nervenkranken Soldaten, den Kopfschüßlern und denen, die im Schützengraben verschüttet worden sind. Im Nachtdienst ist sie allein in der Abteilung. Manchmal schläft Anna ein, vor Erschöpfung oder Heimweh, dann weckt sie der gellende Schrei eines Patienten. In seinem Kopf ist immer noch Krieg und hört nicht auf, Krieg zu sein, und sie hat alle Hände voll zu tun, den Kranken ruhigzustellen.
[11] In die Geschichte meines Namensvetters tritt jetzt der Mann, zu dem er später Vater sagen wird. Der Mann hat bei den Dragonern gedient, widerwillig, als eingefleischter Sozialdemokrat, dann ist es ihm gelungen, die Zeit im Lazarett herunterzubiegen. Er wohnt im Portiershaus bei seinem Vater, der die Fuhrwerke der Lieferanten abwiegen muß. Vielleicht ist er der erste Mensch, der Anna Pospischil nicht auslacht. Vielleicht macht er ihr schöne Augen, vielleicht greift er ihr bei der erstbesten Gelegenheit unter den Rock. Vielleicht akzeptiert sie alles, wenn sie nur nicht länger allein ist. Der Mann schwängert Anna, während des Nachtdienstes in der Schwesternkammer, oder nach Dienstschluß im weitläufigen Anstaltspark. Die Anstaltsleitung bietet ihr eine Stube im Pavillon an, dort könnte sie wohnen und das Kind zur Welt bringen. Kommt überhaupt nicht in Frage, ruft der Mann. Bei meinen Eltern ist Platz! Aber die Eltern wollen Anna nicht haben, schon gar nicht als Schwiegertochter, sie schieben ihr abends eine Matratze hinaus auf den Gang. Irgendwann wird doch geheiratet. Jetzt heißt Anna Pospischil Anna Hackl. Das junge Ehepaar sucht sich eine Wohnung in Ottakring, in einer verrufenen Gegend nahe der Vorortelinie, Zimmer und Küche, es hat kein Geld für Möbel, muß den Küchenboden reparieren, der sich gesenkt hat; als das Kind zur Welt kommt, im Oktober achtzehn, wird ein Waschtrog angeschafft.
Das Haus in der Nauseagasse steht noch, Nummer 31, gleich an der Ecke Wilhelminenstraße. Ein vierstöckiger Bau aus der Gründerzeit, die Haustür befindet sich an der rechten Seite, hinter ihr führt die Stiege ins Hochparterre. An der Fassade wurde nicht gespart, Sandsteingesimse über [12] den Fenstern mit Kunststoffrahmen, neben der Tür ist jetzt eine Gegensprechanlage mit den Namen von siebzehn Hausparteien, damals waren es über dreißig, nur ein Mieter im dritten Stock hatte bereits Gaslicht, überall sonst hingen Petroleumlampen, auch im Stiegenhaus, wo die Hausbesorgerin jeden Tag die verrußten Zylinder putzte. Vor dem Haus saßen an sonnigen Tagen die Alten und keiften und schmunzelten über die Kinder, die auf der Straße Fußball oder Tempelhüpfen spielten. Die Werkstatt im Souterrain steht heute leer, war einst an den Juden Drucker vermietet, der nur von Zigaretten und schwarzem Kaffee gelebt hat, arm wie eine Kirchenmaus.
Notzeit also, und wo es nichts zu beißen gibt, verkommen die Sitten. In der Nauseagasse wird gerauft und gestritten, Einbrecher und Gerichtsvollzieher drücken einander die Türschnalle in die Hand, die Männer, Kriegsheimkehrer, tragen den Lohn oder das Stempelgeld zum Branntweiner. Durch das Bild, das wir uns von ihm machen, torkelt Ferdinands Vater. Die Mutter, an der Hand den Buben, läuft über die Straße, zu dem Mann hin: Ich brauch Geld für die Kohlen. Laß anschreiben! sagt der Vater.
Auch für eine Hose reicht das Geld nicht. Ferdl muß sich mit dem verschlissenen Kittel des Nachbarmädchens bescheiden, das zusieht, wie ihm die Mutter aus Lumpen eine Puppe zusammendreht, erstes Spielzeug für den Buben, der außer sich ist vor Freude. Abends kommt der Vater nach Hause. Schau, sagt die Mutter, der Ferdi hat ein Schwesterlein gekriegt. Und Ferdl läuft strahlend zum Vater und hält die Puppe empor. Der Mann nimmt die Puppe und schleudert sie in eine Ecke.
[13] Jetzt Frankstadt, Mähren, feuchte Kammer der Großeltern. Ferdl ist drei oder vier Jahre alt. Seine Mutter hält einen Brief in der Hand. Vielleicht weint sie. Vielleicht fragt er sie, warum sie weint. Sie sagt, sie ist traurig, weil Papa eine andere hat. In dem Brief steht, dies ist eine Warnung. Es sind falsche Gerüchte im Umlauf. Laß Dich, wenn Du nach Hause kommst, auf kein Gerede mit den Hausparteien ein. Solltest Du die Absicht haben, es dennoch zu tun, so kannst Du gleich bleiben, wo Du bist. Als sie nach Wien zurückkommen, geht die Mutter den Nachbarinnen aus dem Weg. Aber nach ein paar Tagen erfährt sie doch Genaueres über das Pantscherl oder Gschpusi, das der Vater mit zwei oder drei Frauen im Haus unterhalten hat.
Irgendwann paßt Ferdl nicht mehr in den Waschtrog. Jetzt darf er im Ehebett schlafen. Einmal ist seine Tante, die Schwester der Mutter, auf Besuch. Sie ist auch nach Wien ausgewandert, wo sie eine Stelle als Köchin gefunden hat. Ferdl sieht sie vom Bett aus. Auch seine Mutter liegt schon im Bett. Die Tante verabschiedet sich, und Ferdls Vater sagt, er begleitet sie noch zur Tramway.
Geh nicht, sagt die Mutter, bleib da.
Bist still!
Bitte bleib da.
Die Mutter beginnt zu weinen. Da schaut die Tante den Vater an.
Hau ihr eine rein, sagt sie, wenn s’ heulen tut.
Ins Zimmer darf Ferdl nur zum Schlafen. Tagsüber hat er auf dem Mistkistl zu hocken, gleich neben dem Herd. Die Kiste hat einen Deckel; unter dem Deckel wird der Abfall gesammelt. Einmal in der Woche ist von unten das Bimmeln [14] einer Kuhglocke zu hören, dann wissen die Hausparteien, der Mistbauer kommt! Und sie laufen mit dem Mistkistl hinunter, stellen es aufs Trottoir, und dann hält der Mistbauer und kippt den Abfall auf sein Fuhrwerk. Dann gehen sie wieder hinauf, die Hausparteien. Dann wird das Mistkistl wieder in die Küche gestellt. Dann sitzt Ferdl wieder an seinem Platz. Hier ißt er, hier liest er, hier macht er später seine Hausaufgaben. Das Heft darf er auf der Klappe der Küchenkredenz ablegen, die irgendwann angeschafft wurde, lang bevor ein Tisch ins Haus kam.
Seit Ferdl in den Kindergarten geht, arbeitet die Mutter in der Schokoladenfabrik Deutsch, fünf Minuten vom Haus in der Nauseagasse entfernt. In der Fabrik ist es dreckig. Mäuse fressen die Kartons an, im Hof kriechen Ratten durch das Kanalgitter. Vor Weihnachten dürfen die Frauen zu Hause Extraschichten einlegen. Die Mutter schleppt Kartons mit Schokolade und Silberpapier in die Wohnung. Am Sonntag dann sitzt Ferdl zwischen seinen Eltern im Bett – unter der Tuchent ist es warm, zum Heizen fehlen immer noch die Kohlen – und wickelt die Schokolade in buntbedrucktes Stanniol. An das kurze Gefühl der Geborgenheit, damals, wird er sich noch im Alter erinnern.
Die Mutter ist neugierig. Sie tratscht gern. Sie geht an die Tür horchen, wenn andere Frauen draußen an der Bassena Neuigkeiten austauschen. Sie lauscht angestrengt, wenn der Taxichauffeur von der Wohnung unter ihnen besoffen nach Hause kommt und sich die Seele aus dem Leib brüllt, wenn etwas klirrend zerbricht, wenn ein dumpfer Schlag zu hören ist, und ein Schrei und das Weinen und Jammern seiner Töchter. Dann preßt Anna Hackl ihr Ohr gegen...