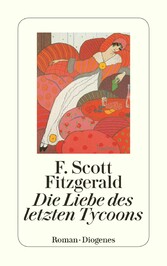Suchen und Finden
Service
Die Liebe des letzten Tycoon - Ein Western
F. Scott Fitzgerald
Verlag Diogenes, 2013
ISBN 9783257602708 , 240 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[7] 1
Ich bin zwar nie auf der Leinwand in Erscheinung getreten, aber mit dem Film aufgewachsen. Als ich fünf wurde, war Rudolph Valentino auf meiner Geburtstagsparty, zumindest hat man mir das erzählt. Ich erwähne das nur, um deutlich zu machen, dass ich schon im zarten Kindesalter beobachten konnte, wie der Betrieb dort lief.
Eigentlich wollte ich ja mal meine Memoiren schreiben – Die Tochter des Produzenten –, aber mit achtzehn kommt man dazu irgendwie nicht mehr, und das ist auch gut so, das Ergebnis wäre so unverdaulich wie eine alte Kolumne von Lolly Parsons. Mein Vater war in der Filmbranche, so wie andere Väter etwa in der Baumwoll- oder Stahlbranche sind, und ich ertrug es mit Gelassenheit. Im schlimmsten Fall akzeptierte ich Hollywood so ergeben wie ein Gespenst, dem man ein bestimmtes Spukhaus zugewiesen hat. Natürlich wusste ich, welche Einstellung zu Hollywood von einem erwartet wurde, aber ich habe es immer standhaft abgelehnt, in das allgemeine Gezeter einzustimmen.
Das ist leicht gesagt, aber sehr viel schwerer zu vermitteln. Unter den Englischdozenten in Bennington gab es einige, die so taten, als ließe Hollywood samt seinen Machwerken sie kalt, in Wirklichkeit aber war es ihnen verhasst – [8] zutiefst verhasst, ja, sie empfanden es als eine existentielle Bedrohung. Vorher, in der Klosterschule, bat mich eine liebe kleine Nonne, ihr das Script für ein Drehbuch zu besorgen; sie wolle ihren Schülerinnen »beibringen, wie man für den Film schreibt«, so wie sie ihnen das Essay- und das Shortstory-Schreiben beigebracht hatte. Ich verschaffte ihr das Script und vermute, dass sie darüber in langes Grübeln verfallen ist, aber im Unterricht fiel kein Wort darüber, und sie gab es mir mit einem Ausdruck gekränkter Überraschung und ohne jeden Kommentar zurück. Ich habe fast den Eindruck, dass es dieser Geschichte hier ähnlich ergehen könnte.
Man kann Hollywood als gegeben hinnehmen, wie ich es gemacht habe, oder es mit jener Verachtung abtun, die wir dem vorbehalten, was wir nicht verstehen. Verstehen lässt es sich im Übrigen durchaus, allerdings nur schemenhaft und in kurzen, flüchtigen Momenten. Maximal ein halbes Dutzend Männer hat jemals den Überblick über die ganze Welt des Films behalten können. Und eine Frau kann die Sachlage vielleicht noch am ehesten erfassen, wenn sie versucht, einen dieser Männer zu verstehen.
Die Welt vom Flugzeug aus war mir vertraut. Vater hatte immer darauf bestanden, dass wir ins Internat und ins College flogen. Nach dem Tod meiner Schwester in meinem ersten Studienjahr reiste ich allein hin und her und musste dabei ständig an sie denken, so dass mich ein Flug immer in eine leicht feierliche und gedämpfte Stimmung versetzte. Manchmal waren Filmleute an Bord, die ich kannte, und hin und wieder – während der Depression allerdings eher [9] selten – ein attraktiver Collegeboy. Im Flugzeug ließen mich die Gedanken an Eleanor und das Gefühl des scharfen Kontrasts zwischen der einen und der anderen Küste nicht richtig schlafen oder zumindest erst dann, wenn die einsamen kleinen Flughäfen von Tennessee hinter uns lagen.
Diesmal war der Flug so unruhig, dass sich die Passagiere sehr schnell aufteilten in solche, die sich sofort hinlegten, und andere, denen das erst gar nicht in den Sinn kam. Von dieser Fraktion saßen zwei in meiner Reihe, aber auf der anderen Gangseite, und nach dem, was ich in Bruchstücken von ihrem Gespräch mitbekam, war ich mir ziemlich sicher, dass sie aus Hollywood waren – dem einen sah man es schon an, es war ein Jude in mittleren Jahren, der abwechselnd in nervöser Erregung redete wie ein Wasserfall oder wie zum Sprung bereit dasaß und sich in lastendes Schweigen hüllte; der andere, ein blasser und unscheinbarer, untersetzter Mann um die Dreißig, kam mir bekannt vor. Möglicherweise hatte er uns mal zu Hause besucht, vielleicht aber war das schon lange her, und ich war damals noch klein gewesen, ich nahm es ihm deshalb nicht übel, dass er mich nicht erkannte.
Die Stewardess – sie war groß, hübsch und auffallend dunkel, ein offenbar weitverbreiteter Typ in diesem Beruf – fragte, ob sie mir meine Schlafkabine richten solle.
»Und möchten Sie ein Aspirin?« Sie schob sich, in dem Sommersturm gefährlich taumelnd, seitlich auf meinen Sitz. »Oder ein Nembutal?«
»Nein.«
»Ich hatte bis jetzt so viel mit den anderen zu tun, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, Sie zu fragen.« Sie [10] setzte sich neben mich und schnallte uns beide an. »Kaugummi?«
Es war ein willkommener Anlass, den Kaugummi loszuwerden, mit dem ich mich seit Stunden herumärgerte. Ich wickelte ihn in die herausgerissene Ecke einer Zeitschriftenseite und legte ihn in den automatischen Aschenbecher.
»Nette Leute erkenne ich immer daran«, sagte die Stewardess anerkennend, »dass sie ihren Kaugummi in Papier wickeln, ehe sie ihn da hineintun.«
Wir saßen eine Weile im Halbdunkel der schwankenden Kabine beieinander. Ich kam mir ein bisschen vor wie in einem vornehmen Restaurant in den Intervallen zwischen den Gängen. Wie dort saßen wir da und warteten, ohne genau zu wissen, was auf uns zukommen würde. Ich glaube, dass selbst die Stewardess sich ständig in Erinnerung rufen musste, warum sie hier war.
Wir sprachen über eine junge Schauspielerin, die ich kannte und mit der sie vor zwei Jahren in den Westen geflogen war. Es war zur schlimmsten Zeit der Wirtschaftskrise, und die junge Schauspielerin hatte so starr aus dem Fenster gesehen, dass die Stewardess fürchtete, sie könne womöglich springen wollen. Dann aber stellte sich heraus, dass es nicht die Armut war, vor der die junge Frau Angst hatte, sondern allein die Revolution.
»Für Mutter und mich ist schon alles klar«, vertraute sie der Stewardess an. »Wir werden uns in den Yellowstone Park zurückziehen und ein einfaches Leben führen, bis sich die Wogen geglättet haben. Dann kommen wir zurück. Künstler bringen sie nämlich nicht um.«
[11] Ein verlockendes Vorhaben – ich sah das bezaubernde Bild förmlich vor mir: Gütige Torybären bringen der Schauspielerin und ihrer Mutter Honig, sanfte Rehkitze holen eine Extraportion Milch von ihren Müttern und halten sich in der Nähe bereit, ihnen des Nachts als Kissen zu dienen. Ich revanchierte mich mit der Geschichte von dem Anwalt und dem Regisseur, die in jenen bewegten Tagen eines Abends Vater ihre Pläne erzählt hatten. Für den Fall der Einnahme von Washington durch die Bonus-Armee hatte der Anwalt ein Boot am Ufer des Sacramento River versteckt, mit dem er für ein paar Monate stromaufwärts rudern und dann zurückkommen wollte, »denn nach einer Revolution brauchen sie immer Anwälte, um rechtlich alles ins Lot zu bringen«.
Der Regisseur neigte eher zum Defätismus. Er hielt einen alten Anzug, Hemd und Schuhe bereit – ob es seine eigenen Sachen waren oder ob er sie aus der Requisite hatte, kam nicht heraus – und gedachte »sich in der Menge zu verlieren«. Ich höre noch Vater sagen: »Aber man wird sich Ihre Hände ansehen und auf den ersten Blick erkennen, dass die seit Jahren nicht mehr kräftig zugelangt haben. Und man wird Sie nach Ihrem Gewerkschaftsausweis fragen.« Und ich sehe das lange Gesicht des Regisseurs vor mir und erinnere mich, wie niedergeschlagen er seinen Nachtisch in Angriff nahm und wie komisch und kläglich ich die beiden fand.
»Ist Ihr Vater Schauspieler, Miss Brady?«, fragte die Stewardess. »Den Namen hab ich auf jeden Fall schon mal gehört.«
Als der Name Brady fiel, sahen die beiden Männer auf [12] der anderen Seite des Mittelgangs zu mir hin – mit diesem typischen Hollywoodblick, der immer so wirkt, als wenn der Betrachter über die eigene Schulter schaut –, dann löste der blasse untersetzte Junge seinen Sicherheitsgurt und stellte sich neben uns.
»Sind Sie Cecelia Brady?«, fragte er so vorwurfsvoll, als hätte ich ihm etwas vorenthalten. »Sie sind mir gleich so bekannt vorgekommen. Ich bin Wylie White.«
Das hätte er sich schenken können, denn im gleichen Augenblick sagte eine neue Stimme: »Kannst du nicht aufpassen, Wylie?«, und ein Mann schob sich im Gang an ihm vorbei und ging in Richtung Cockpit. Wylie fuhr zusammen und rief ihm, ein paar Sekunden zu spät schaltend, weithin hörbar nach: »Anweisungen nehme ich nur vom Piloten entgegen.«
Ich erkannte eine dieser freundlichen Frotzeleien, wie sie zwischen den Hollywoodgewaltigen und ihren Satelliten üblich sind.
»Nicht so laut, bitte«, wies ihn die Stewardess zurecht, »einige Passagiere schlafen schon.«
Jetzt sah ich, dass der andere Mann, der Jude mittleren Alters, auch aufgestanden war und mit gierigem Blick auf den Mann starrte, der gerade vorbeigekommen war. Oder vielmehr auf den Rücken dieses Mannes, der die Hand wie zu einem Gruß hob, ehe er aus meinem Blickfeld verschwand.
»Ist das der Kopilot?«, fragte ich die Stewardess.
Sie löste unseren Gurt, offenbar gewillt, mich schnöde Wylie White zu überantworten.
»Nein, das ist Mr. Smith. Er hat die Privatkabine, die [13] sogenannte ›Hochzeitssuite‹, aber er hat sie für sich allein. Der Kopilot trägt immer Uniform.« Sie stand auf. »Ich will mal eben fragen, ob wir in Nashville am Boden bleiben müssen.«
»Warum?«, fragte Wylie White entsetzt.
»Im Mississippi Valley zieht eine Gewitterfront heran.«
»Soll das heißen, dass wir die ganze Nacht hier verbringen müssen?«
»Wenn das so weitergeht…«
Ein unerwartetes Luftloch machte deutlich, dass damit zu rechnen war. Es...