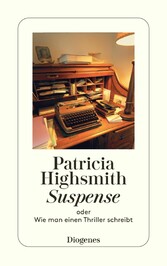Suchen und Finden
Service
Suspense - oder Wie man einen Thriller schreibt
Patricia Highsmith
Verlag Diogenes, 2013
ISBN 9783257602098 , 176 Seiten
2. Auflage
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
[13] 1. Der Keim einer Idee
Wenn man ein Buch schreibt, sollte es in erster Linie dem Autor gefallen. Hat man selbst während der Dauer des Schreibprozesses Spaß daran, dann kann und wird es Verlegern und Lesern später ebenso gehen.
Jede Story, die Anfang, Mitte und Schluss hat, hat Suspense – Spannung –, und eine Suspense-Story, ein Thriller, hat naturgemäß mehr davon. Ich werde in diesem Buch das Wort Suspense so benutzen, wie es in Amerika im Verlagswesen benutzt wird: Suspense-Storys sind Geschichten, in denen Gewalt und Gefahr drohen oder tatsächlich vorkommen. Ein weiteres Charakteristikum der Suspense-Storys ist ihr Unterhaltungswert, sie sind gewöhnlich abwechslungsreich und ein wenig trivial. Von einem Thriller erwartet man keine profunden Gedankengänge, keine langen Absätze, in denen nichts passiert. Aber das Schöne am Genre »Suspense« ist, dass es dem Autor überlassen bleibt, ob er profunde Gedanken äußern oder auch Passagen ohne »Action« belassen will, weil ja das Gerüst aus einer per se lebendigen Story besteht. Verbrechen und Strafe ist dafür ein glänzendes Beispiel. Überhaupt würde man vielleicht die meisten von Dostojewskijs Büchern als Suspense-Romane bezeichnen, wenn sie dieser Tage erstmals erschienen. Nur würde man verlangen, dass er sie kürze – wegen der Herstellungskosten.
[14] »Geschichten-Keime« entwickeln
Was ist der Keim einer Idee? Für einen Schriftsteller kann das im Prinzip alles sein: Auf dem Gehsteig stürzt ein Kind, und sein Eis fällt zu Boden. Ein respektabel aussehender Mann steckt im Lebensmittelgeschäft heimlich, doch wie unter Zwang, eine Birne ein und geht, ohne zu bezahlen, weg. Es kann auch eine kurze Abfolge von Ereignissen sein, die einem ohne äußeren Anlass und sozusagen aus heiterem Himmel in den Sinn kommt. Von dieser Art sind die meisten meiner Ideenkeime. Der Keim für den Plot von Zwei Fremde im Zug war zum Beispiel dies: »Zwei Menschen vereinbaren den Mord am Feind des jeweils anderen und sorgen so für ein perfektes Alibi.« Der Ideenkeim für ein anderes Buch, Der Stümper, war zuerst weniger vielversprechend, eher störrisch, was seine Entwicklung betraf, aber von einer solchen Hartnäckigkeit, dass er mir länger als ein Jahr nicht aus dem Kopf ging und mir keine Ruhe ließ, bis ich einen Weg fand, darüber zu schreiben. Er lautete: »Zwei Verbrechen ähneln sich auffallend, obwohl die Täter einander nicht kennen.«
Viele Schriftsteller würde diese Idee wahrscheinlich gar nicht interessieren. Es ist eine »Na und?«-Idee, sie braucht schmückendes Beiwerk und einige Komplikationen. In dem Roman, der dabei herauskam, ließ ich das erste Verbrechen von einem einigermaßen kaltblütigen Killer begehen, das zweite von einem, der den ersten – amateurhaft – nachahmen wollte, weil er glaubte, der erste Killer sei damit davongekommen. Und das wäre er auch, hätte nicht der zweite Mann den stümperhaften Versuch [15] unternommen, ihn zu imitieren. Der zweite führte seine Tat nicht mal zu Ende – er kam nur bis zu einem gewissen Punkt, einem Punkt, an dem die Ähnlichkeit so auffiel, dass ein Kriminalbeamter aufmerksam wurde. So können in einer »Na und?«-Idee mehrere Varianten stecken.
Es gibt Ideen, die sich niemals aus sich selbst heraus entwickeln; sie brauchen eine zweite Idee, um in Gang zu kommen. Ein solcher ineffektiver Geschichtenkeim war der Ursprung von Der süße Wahn. »Ein Mann will sich durch den alten Versicherungstrick Geld beschaffen: Er schließt eine hohe Lebensversicherung ab, kommt dann scheinbar zu Tode oder ist verschollen und streicht schließlich die Versicherungssumme ein.« Es muss sich doch ein Weg finden lassen, dachte ich, dieser Idee einen neuen Dreh zu geben und eine frische und fesselnde neue Story daraus zu machen. Wochenlang zerbrach ich mir abends den Kopf darüber. Mein verbrecherischer Held sollte unter neuem Namen ein anderes Haus beziehen, ein Haus, in dem er endgültig wohnen konnte, wenn sein wahres Ich allem Anschein nach tot war. Aber die Idee wollte einfach nicht lebendig werden. Eines Tages dann kam der Anstoß – in diesem Fall ein weit besseres Motiv, als mir bisher in den Sinn gekommen war: ein Liebesmotiv. Der Mann richtet das zweite Haus für das Mädchen ein, das er liebt, aber, wie sich im Roman herausstellt, niemals für sich gewinnen kann. Die Versicherung oder das Geld interessierte ihn gar nicht, denn Geld hatte er. Es war ein Mann, der von seinen Gefühlen besessen war. In mein Notizbuch schrieb ich unter all die fruchtlosen Eintragungen: »Alles Quatsch«, und verfolgte dann meinen neuen Gedanken [16] weiter. Plötzlich erwachte alles zum Leben. Ein wunderbares Gefühl.
Die Phantasie des Schriftstellers
Eine weitere Story, die zwei Keime brauchte, um zum Leben zu erwachen, war Die Schildkröte, eine Kurzgeschichte, die von den Mystery Writers of America ausgezeichnet wurde und seither oft in Sammelbänden abgedruckt wurde. Der erste Keim wuchs aus einer Geschichte, die eine Freundin über jemanden erzählte, den sie kannte. Von solchen Geschichten erwartet man nicht, dass sie fruchtbare Keime in sich tragen, weil sie nicht von einem selbst stammen. Eine noch so aufregende Geschichte, die einem ein Freund mit der fatalen Bemerkung erzählt: »Ich bin mir sicher, daraus kannst du eine fabelhafte Story machen«, hat für einen Schriftsteller garantiert nicht den geringsten Wert. Wenn es eine Story ist, dann ist sie es bereits zu diesem Zeitpunkt und bedarf nicht mehr der Phantasie eines Schriftstellers; ebenjene Phantasie und seine Gedanken lehnen sie vom künstlerischen Standpunkt her ab, so wie seine Haut die Haut eines anderen abstoßen würde, würde man sie verpflanzen. Über Henry James ist eine Anekdote berühmt geworden, nach der er einmal einen Freund, der ihm eine Geschichte erzählen wollte, schon nach wenigen Worten unterbrochen haben soll. James hatte genug gehört und wollte den Rest lieber seiner Phantasie überlassen.
Aber zurück zur Geschichte über die Schildkröte. Dies also ist die Story: »Eine Witwe, von Beruf [17] Werbezeichnerin, schikaniert ihren zehnjährigen Sohn, lässt ihn die Kleidung viel jüngerer Kinder tragen, verlangt, dass er ihre Arbeit bewundert und macht aus dem Kind einen wahren Neurotiker.« Nun, das war tatsächlich eine ganz interessante Story, und auch meine Mutter war Werbezeichnerin (sie ist aber nicht so wie diese Mutter). Ich trug die Story etwa ein Jahr mit mir herum, doch ich verspürte nie den Drang, sie zu schreiben. Dann blätterte ich eines Abends bei Freunden in einem Kochbuch und stieß auf ein grässliches Rezept für Schildkrötenragout. Das Rezept für Schildkrötensuppe war kaum weniger scheußlich, aber immerhin begann es damit, dass man wartete, bis die Schildkröte den Kopf herausstreckte, den man dann mit einem scharfen Messer abtrennte. Leser, die sich mit einem Thriller langweilen, sollten einmal in einem Kochbuch die Seiten durchsehen, die sich mit unseren gefiederten Freunden und mit Schalentieren befassen. Eine Hausfrau muss schon ein Herz aus Stein haben, um diese Rezepte zu lesen, geschweige denn auszuführen. Für das Ragout tötet man die Schildkröte, indem man sie bei lebendigem Leibe kocht. Das Wort »töten« kam nicht vor, und das war auch nicht nötig, denn wer oder was konnte kochendes Wasser überleben?
Nachdem ich das gelesen hatte, fiel mir das Schicksal des kleinen Jungen wieder ein. Ich würde eine Schildkröte zum Angelpunkt der Story machen: Die Mutter hat eine Schildkröte mitgebracht, um Ragout aus ihr zu machen – eine Schildkröte, von der der Junge zunächst glaubt, sie sei als Haustier für ihn bestimmt. Er erzählt einem Schulfreund davon, um sich beliebter zu machen, und verspricht, sie ihm zu zeigen. Dann muss der Junge zusehen, wie die [18] Schildkröte in kochendem Wasser getötet wird, und die ganze aufgestaute Bitterkeit, der schwelende Hass auf die Mutter, brechen aus ihm heraus. In der Nacht tötet er die Mutter mit dem Küchenmesser, das sie zum Tranchieren der Schildkröte benutzt hatte.
Monatelang, womöglich sogar über ein Jahr, hatte ich vor, einmal einen Teppich als Versteck für eine Leiche zu benutzen, einen Teppich, den vielleicht jemand am helllichten Tage aufgerollt aus einer Haustür trägt – allem Anschein nach zur Reinigung, tatsächlich aber ist eine Leiche darin versteckt. Ich war ziemlich sicher, dass jemand schon einmal etwas Ähnliches geschrieben hatte. Irgendjemand erzählte mir – ich weiß nicht, ob es stimmt –, dass die kriminelle Vereinigung Murder Inc. so ihre Leichen transportiert. Und trotzdem interessierte mich die Idee, und ich versuchte, mir eine andere Möglichkeit auszudenken, wie ich das Thema »Leiche im Teppich« frisch und amüsant und anders anpacken könnte. Eine naheliegende Möglichkeit war die, dass gar keine Leiche drin wäre. Dann müsste derjenige, der den Teppich schleppte, des Mordes verdächtigt werden; man müsste ihn dabei beobachten, wie er (vielleicht verstohlen) den Teppich wegtrug; er musste also, kurz gesagt, etwas Schalkhaftes haben. Im Keim begann sich leise Leben zu regen. Ich verband ihn mit einem anderen Ideenfaden von einem Schriftsteller-Helden, der auf einem sehr schmalen Grat zwischen Wirklichkeit und ausgedachten Plots balanciert und beide manchmal etwas durcheinanderbringt. Ein solcher Schriftsteller-Held, dachte ich, könnte nicht nur amüsant – im Sinne von witzig – sein, er könnte auch die harmlose alltägliche Schizophrenie aufzeigen, von der es [19] überall mehr als genug...