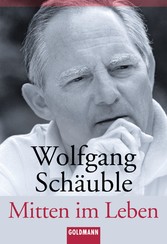Suchen und Finden
Service
Mitten im Leben
Wolfgang Schäuble
Verlag C. Bertelsmann, 2002
ISBN 9783894806811 , 348 Seiten
Format ePUB, OL
Kopierschutz Wasserzeichen
Vor der Wahl 1998 - Der Weg in die Niederlage
1. 16 Jahre Regierungszeit fordern ihren Tribut
Als am 27. September 1998 um Punkt 18 Uhr die Prognosen der Meinungsforschungsinstitute zum Ausgang der Bundestagswahl über die Fernsehschirme flimmerten, wurde es zur Gewissheit: Die CDU hatte die Wahl verloren - nach 16 siegreichen Jahren das erste Mal. Dass es so kam, war für mich zwar nicht mehr überraschend. Doch mit dem Ausmaß der Niederlage hatten nur wenige gerechnet. In der Schlussphase des Wahlkampfs hatten die Umfragen eine Aufholjagd der Union signalisiert, in den Medien wurde über ein Kopf-an-Kopf-Rennen spekuliert, und viele Wahlkämpfer klammerten sich an den Strohhalm, das Wunder, gemeinsam mit der FDP erneut eine Mehrheit zu erzielen, sei doch noch zu schaffen. Zumindest könnten CDU und CSU knapp vor der SPD landen, das hielten selbst seriöse Kommentatoren für nicht ganz ausgeschlossen. Folglich strapazierten sie bis zum Wahltag mit Verve ihr Lieblingsthema »große Koalition«.
Meine Skepsis gegenüber den Zahlenspielereien wich jedoch nicht. Da auch nach dem 27. September mit fünf Fraktionen im Bundestag zu rechnen war, hätte es schon einen enormen »last minute swing« geben müssen, um die Union in die Lage zu versetzen, den Kanzler stellen zu können. Und davon war trotz einer guten Schlussmobilisierung unserer Anhänger nichts zu spüren. So kam es, dass wir das schlechteste Wahlergebnis seit 1949 einfuhren. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde ein Regierungswechsel unmittelbar durch eine Wahl ausgelöst.
Es war also völlig klar, dass dieser 27. September 1998 eine tiefe Zäsur markierte, deren Auswirkungen zunächst gar nicht voll zu übersehen waren, die aber die CDU auch über das Jahr 2000 hinaus noch beschäftigen werden. Die Niederlage beendete 16 Jahre Regierungsverantwortung, eine für westliche Demokratien ebenso ungewöhnlich lange wie erfolgreiche Zeit. In der ersten Hälfte dieser 16 Jahre hatten wir mit den klassischen Mitteln der sozialen Marktwirtschaft eine wirtschaftliche Dynamik in Gang gesetzt, die zu großen Erfolgen am Arbeitsmarkt und bei der Geldwertsta-bilität führte. Der europäische Einigungsprozess gewann gegen verbreitete Skepsis neue Fahrt und steuerte mit der 1986 verabschiedeten Einheitlichen Europäischen Akte die Vollendung des Binnenmarkts an, die nächste Etappe auf dem Weg zum ehrgeizigen Ziel der Wirtschafts- und Währungsunion. Die atlantische Solidarität wurde vor allem durch unseren unbeirrbaren Kurs in der Nachrüstungspolitik der Nato deutlich gestärkt und führte zusammen mit der Überlegenheit freiheitlicher Ansätze in der Wirtschaft und im gesellschaftlichen System des Westens zur Implosion des kommunistischen Herrschaftsbereichs. Der Kalte Krieg wurde friedlich entschieden. Kulminationspunkte dieser sich immer mehr beschleunigenden Entwicklung waren der symbolträchtige Fall der Mauer und die deutsche Wiedervereinigung.
Die zweite Hälfte der sechzehnjährigen Regierungszeit der Union stand im Zeichen der Vollendung der deutschen Einheit, des weiteren Ausbaus der europäischen Einigung und der mühsamen Suche nach einer neuen Weltordnung. Der Sieg der Freiheit, das Ende der Bipolarität eröffneten eine Welt mit ganz neuen Chancen. Aber damit einher gingen in den Neunzigerjahren auch dramatische Veränderungen in dieser entgrenzten Welt, beschrieben mit dem Begriff »Globalisierung«. Revolutionäre Entwicklungen in Wissenschaft und Forschung, insbesondere bei den Kommunikationstechnologien mit kaum zu überblickenden Folgen für Märkte und Arbeitswelt, schufen neben all den positiven Möglichkeiten auch zunehmend Verunsicherung bei vielen Menschen. Allein die neuen Kommunikationsformen, symbolisiert durch den atemberaubenden Siegeszug von Handy und Internet, erzeugten einen sich verstärkenden Modernisierungsdruck, der mit immer größerer Wucht auf die eher behäbigen und teilweise sogar beharrenden gesellschaftlichen Befindlichkeiten drückte. Zwar nahm das kollektive Bewusstsein, in einem enormen Reformstau zu stecken, in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre rapide zu. Doch zugleich wehrte man sich im Alltag gegen Veränderungen. Daraus entwickelte sich eine diffuse Grundstimmung, das eigentliche Übel sei die Politik, die nichts zuwege bringe und schlicht reformunfähig sei. Zusammen mit einem zunehmenden Überdruss an »immer denselben Gesichtern« an der Spitze der Regierung wuchs allmählich die Bereitschaft zum politischen Wechsel samt Quittung für alle Unzufriedenheiten. Der 27. September 1998 wurde zum Zahltag.
2. Ermüdungsprozesse in der Koalition
Das Wahlergebnis war im Grunde also für die Union ebenso vorhersehbar wie unvermeidlich. Alarmzeichen hatte es ja schon viel früher gegeben. Bereits in der Mitte der Legislaturperiode 1990 bis 1994 war die Koalition von CDU/CSU und FDP in ein tiefes Meinungsloch gefallen. Der anfängliche Wiedervereinigungsbonus schmolz wie Schnee in der Sonne, Enttäuschungen vor allem in den neuen Bundesländern machten sich breit. Hinzu kamen wirtschafts- und finanzpolitische Probleme, die nicht nur, aber doch zum überwiegenden Teil mit den enormen Folgelasten von 40 Jahren Teilung und Sozialismus zusammenhingen. Nach einer dramatischen Aufholjagd, die durch schwere Fehler des damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Scharping begünstigt wurde, gelang es der Koalition, die Bundestagswahl doch noch zu gewinnen, allerdings nur mit hauchdünnem Vorsprung. Lediglich durch Überhangmandate konnten wir uns einen Zehn-Stimmen-Vorsprung im Bundestag sichern - eine Mehrheit, die keineswegs so komfortabel war, wie sie auf den ersten Blick aussah. Im Gegenteil, angesichts der enormen Probleme, die es zu lösen galt, begann damit ein permanenter Stresszustand, weil diese knappe Mehrheit bei oft widerstreitenden Interessen im Regierungslager immer wieder neu organisiert werden musste. Wer aus Erfahrung lernen wollte, konnte damals nachträglich die Lage der SPD-FDP-Koalition von 1969 studieren mit ihrer ähnlich schmalen Mehrheit.
Der Wahrheit halber muss noch angemerkt werden, dass die Regierungszeit der Union mit allergrößter Wahrscheinlichkeit bereits 1990 geendet hätte, wenn nicht der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung die Karten völlig neu gemischt hätten. Gleichwohl machte uns die Verantwortung für die deutsche Einheit unter dem Gesichtspunkt politischer Stimmung schon wenige Jahre nach der Einheit nicht mehr nur eitel Freude. Die Mühen um den Aufbau Ost und die vielfältigen Enttäuschungen und Brüche in Ost und West haben auch in der Legislaturperiode bis 1998 die Zustimmung zur Politik der Bundesregierung immer wieder eingetrübt.
Unser eigentliches Problem jedoch waren die ansteigenden Arbeitslosenzahlen. Bei den vielen Diskussionen um Lösungswege gerieten immer wieder die Sozialpolitiker mit den Wirtschaftsliberalen aneinander. Die Konfliktlinien liefen sowohl quer durch die Unionsfraktion als auch zwischen CDU/CSU und FDP. In der Presse wurde häufiger prognostiziert, der »Vorrat an Gemeinsamkeiten« in der Koalition sei aufgebraucht, das Regierungsbündnis werde sich nicht mehr lange halten können. Und umgehend stieg wieder das Gespenst der großen Koalition aus seiner Modergruft. Ich habe das immer für Unsinn gehalten, vor allem, weil es nach wie vor zwischen CDU/CSU und FDP eine Übereinstimmung in den grundsätzlichen Fragen unserer Politik gab. Dass die Nerven dennoch öfter blank lagen, ist allerdings auch wahr, und das hatte etwas damit zu tun, dass die Akzeptanz dessen, was wir auf den Weg brachten, in der Öffentlichkeit nicht besser werden wollte. Zwar wurde in der Legislaturperiode 1994 bis 1998 eine Vielzahl von Reformen auf den Weg gebracht (Einkommensteuer, Gesundheit, Rente, Lohnfortzahlung, Kündigungsschutz), und der Zuwanderungsdruck mit all den heiklen Folgen für die innenpolitische Diskussion beruhigte sich weitgehend, nachdem die Änderung des Asylrechts ihre Wirkungen entfaltete. Auch die Verstetigung des Aussiedlerzugangs trug zur Entspannung einer wenige Jahre zuvor noch äußerst labilen und deshalb nicht ganz ungefährlichen Stimmungslage bei. Immerhin hatten wir es geschafft, die jährliche Zuwanderung von Aussiedlern auf maximal 200000 zu begrenzen, wobei die tatsächlichen Zugangszahlen im Laufe der Neunzigerjahre weiter zurückgingen. Aber dennoch standen wir vor dem Phänomen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung unsere Reformansätze einerseits als zu spät oder zu zögerlich eingeschätzt wurden, andererseits aber fast jeder konkrete Reformschritt den meisten Menschen schon wieder zu weit ging. Was erfolgreich zustande gebracht worden war, wurde in der Öffentlichkeit als erledigt betrachtet, ohne dass uns daraus ein längerfristig wirksamer Bonus erwachsen wäre. Dafür wirkten die ungelösten Probleme zusammen mit dem subjektiven Ärger über die eine oder andere Belastung infolge der beschlossenen Reformen massiv gegen uns.
Es war wohl unser größter Fehler in diesen vier Jahren, dass wir es nicht geschafft hatten, unsere Reformen in einen den Menschen plausiblen Gesamtzusammenhang zu stellen. Immer wieder waren wir konfrontiert mit enervierenden und die Ressourcen bindenden Detaildebatten. Über die Frage einer äußerst maßvollen Besteuerung von Spitzenrenten brachten es unsere eigenen Leute fertig, den großen Wurf unseres Petersberger Steuerreformkonzepts - Reduzierung aller Steuersätze um zirka ein Drittel bei Abschaffung zahlreicher Ausnahmen von der Besteuerung und einer Nettoentlastung in einer Größenordnung von 30 bis 40 Milliarden Mark - schon gleich zu Anfang kaputtzureden. Die Zuzahlung bei Medikamenten auf Rezept, eine wesentliche Voraussetzung, aber insgesamt nur ein Teil unseres Gesamtkonzepts für den dringend erforderlichen Einspareffekt im Gesundheitswesen, war nicht nur der Boulevardpresse dicke Schlagzeilen wert, sodass wir auch hier ständig in Abwehrkämpfen gegen Unterstellungen und andauernden Erklärungszwängen standen. Dies sind nur zwei Beispiele, die zeigen, wie eine an vielen Problemstellen ansetzende und in eine Gesamtkonzeption eingebettete Reformpolitik im öffentlichen Kleinkrieg zerschlissen werden kann.
Außerdem kamen wir mit unseren Reformkonzepten erst in der Mitte der Legislaturperiode über. Nach der Wahl 1994 hatten wir in den Koalitionsverhandlungen Zeit verloren. Um die Neuordnung des Staatsangehörigkeitsrechts hatten wir buchstäblich bis zur Erschöpfung gerungen, mit der Folge, dass sich niemand an die Umsetzung des erarbeiteten Kompromisses machen wollte. Eine große Steuerreform mochte Theo Waigel 1995 noch nicht in Angriff nehmen, weil zunächst durch ein Verfassungsgerichtsurteil die Steuerfreiheit des Existenzminimums und des Familienlastenausgleichs zum 1. Januar 1996 in Kraft treten musste. Waigel fürchtete zu Recht, dass diese Operation - es handelte sich immerhin um ein Finanzvolumen von rund 30 Milliarden DM - im Bundesrat an der rot-grünen Mehrheit scheitern würde, wenn zusätzliche Reformelemente damit verbunden würden. Lafontaine, damals Wortführer der SPD-geführten Landesregierungen, der so genannten »A-Länder«, warnte nämlich vorsorglich schon vor einem »Draufsatteln«. Und schließlich stritten wir innerhalb der Union und in der Koalition kräftig um die Berücksichtigung ökologischer Elemente in der Steuerpolitik. Weil Reformen in der Politik immer zunächst auf Widerstand stoßen, wurde der Zeitverlust innerhalb der Legislaturperiode zum zusätzlichen Problem - sowohl innerhalb der Regierungskoalition als auch hinsichtlich der verbesserten Chancen der rot-grünen Mehrheit im Bundesrat, gegen Ende der Legislaturperiode eine Blockade durchzuhalten.
Viel Kraft kostete uns zudem die Diskussion um die Einführung des Euro. Der Abschied von der D-Mark war ein Prozess, in den sich viele Menschen gerade in den neuen Bundesländern, aber natürlich auch in der älteren Generation nur mühsam einfanden. Das latente Misstrauen in der Bevölkerung blieb nicht ohne Wirkungen in der Union. Insbesondere der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber mahnte eindringlich vor einer zu schnellen Einführung, weil er fürchtete, dass die eher lasche Haushaltspolitik einiger Beitrittsaspiranten den Euro auf Kosten der D-Mark zur Weichwährung machen und damit erst recht das breite Wasser der Vorbehalte in Deutschland auf die Mühlen rechtsradikaler Kräfte lenken könnte. Der CSU-Vorsitzende und Finanzminister Theo Waigel geriet dadurch ein ums andere Mal intern wie international in unangenehme Zwickmühlen, die er schließlich nur dadurch umgehen konnte, dass er in zäh und mit bewundernswerter Zielstrebigkeit geführten Verhandlungen mit den europäischen Partnern einen Stabilitätspakt zustande brachte, der die Euro-Teilnehmer auch nach der Erfüllung der zur Teilnahme berechtigenden Stabilitätskriterien zur stringenten Haushaltspolitik verpflichtete.
Theo Waigel gehörte ohnehin zu den am meisten geplagten und geprügelten Politikern der Koalition. Durch die enormen Transferleistungen für den Aufbau Ost, die zunehmend kritischere Situation der Sozialversicherung wegen der hohen Arbeitslosenzahlen und die Auswirkungen der schwierigen Konjunkturlage auf das Steueraufkommen waren die Finanzspielräume der Bundesregierung gleich null. Wenn gespart werden muss, finden das zwar grundsätzlich alle gut, nur nicht die, bei denen dann tatsächlich gespart wird. Waigel konnte es zwangsläufig niemandem recht machen, und so war er bald ins Fadenkreuz aller Kritik geraten, die auf uns einprasselte.
Natürlich hatte sich die Staatsverschuldung im Zuge der Aufbauleistungen für die neuen Bundesländer erhöht. Die Ministerpräsidenten hatten den Bund beim Solidarpakt, der die Verteilung der Sonderlasten für den Aufbau Ost zwischen Bund und Ländern samt Gründung des Fonds Deutsche Einheit und der Einführung des Solidaritätszuschlags regeln sollte, regelrecht über den Tisch gezogen, sodass wir eher mehr denn weniger in die Finanzklemme gerieten. Außerdem hatte der staatliche Zuschuss zur Sozialversicherung wegen der stark angestiegenen Arbeitslosenzahlen und aus strukturellen Gründen nie gekannte Höhen erklommen. Die heftige öffentliche Debatte traf uns umso unangenehmer, als mit dem Thema Staatsverschuldung ein Markenzeichen der Union, nämlich die finanzielle Solidität, in seinem Kern angegriffen wurde.
Es erhielt schon deshalb immer wieder neue Nahrung, weil andauernd darüber spekuliert wurde, ob Deutschland angesichts seiner Schuldenlage die Maastricht-Kriterien bei der Neuverschuldung erfüllen würde, ohne die es keinen Start in die Währungsunion geben konnte. Den - allerdings nicht nur daraus - resultierenden Sparzwang hatten wir 1993 insoweit institutionalisiert, als wir beschlossen, die Ausgaben des Bundeshaushalts Jahr für Jahr zu reduzieren. Das allerdings bescherte uns bei jeder Haushaltsaufstellung heftige interne Diskussionen, weil sich natürlich die Gestaltungsspielräume ständig verminderten. Trotz aller Einsicht in die Notwendigkeiten gab das immer wieder Anlass zu Missmut, der sich vorrangig gegen den Finanzminister richtete. »Sparen für Maastricht« - diese vergiftete Formel fiel auch bei manch einem frustrierten Fraktionskollegen auf nicht ganz unfruchtbaren Boden und machte die Lage nicht leichter.
3. Reformpolitik und SPD-Blockade
Viel stärker wurde die Situation noch dadurch erschwert, dass auch unsere sozialpolitischen Reformdebatten in diese kurzsichtige Optik gerieten. Mit dem ebenso unzutreffenden wie wirkungsvollen Argument von der falschen Finanzierung der deutschen Einheit und der wohlfeilen Erinnerung an das gebrochene Versprechen von 1990, die Wiedervereinigung ohne Steuererhöhungen bewältigen zu können, das die SPD geradezu gebetsmühlenartig wiederholte, wurde in der Öffentlichkeit der Eindruck befördert, die finanzielle Malaise sei nicht aus strukturellen Gründen entstanden, sondern alleinige Schuld falscher Regierungspolitik. Finanzminister Waigel nutzte jede sich bietende Gelegenheit, die Haus-haltsspielräume zu vergrößern, insbesondere durch Privatisierungserlöse, wohlwissend, dass sie nur einmal zu Buche schlagen. Der Versuch jedoch, Anfang Mai 1997 über eine maßvolle Neu-bewertung der Goldreserven der Bundesbank finanzpolitische Handlungsspielräume zu erschließen, wurde zum Desaster. Schon Tage vorher quoll die Gerüchteküche über, die Bundesregierung wolle sich »wegen Maastricht« am Bundesgold »vergreifen«.