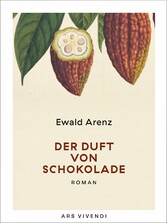Suchen und Finden
Service
Der Duft von Schokolade (eBook)
Ewald Arenz
Verlag ars vivendi, 2009
ISBN 9783869133249 , 270 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
1
Im Frühjahr 1881 quittierte der Leutnant August Liebeskind nach fast zehn Jahren den Dienst in der kaiserlichen und königlichen Armee Österreich-Ungarns. Es war ein regnerischer Tag, aber der Himmel war hell, und der Duft von Gras und Sonne lag schon als verwehter Hauch und wie ein Versprechen in der kühlen, grauen Luft, als August den Hof der Stiftskaserne durchquerte. Offiziell war er jetzt schon kein Soldat mehr, aber er grüßte die Wachhabenden am Tor wie gewohnt. Dann trat er auf die Mariahilfer Straße, blieb stehen und lächelte.
Das war alles. Er konnte stehen bleiben und weitergehen, wie es ihm gefiel. Es gab keinen Dienst mehr und keine Befehle. Er war frei. Hatte sich der Duft der Luft geändert? Er atmete tief ein und fand, dass sie wirklich anders roch. Sie roch frei. Ein klarer Geruch. Er schob die Mütze ein Stück aus der Stirn, und schon begann die Uniform, sich ein bisschen ungewohnter anzufühlen, so wie damals, als er sie das erste Mal getragen hatte.
Eigentlich war er nicht ungern Soldat gewesen, aber ein Schönwetterleutnant, dachte er, über sich selbst amüsiert, und grüßte noch ein letztes Mal, als ein kleiner Trupp durch das Tor kam und an ihm vorbei nach rechts abbog. Er war nie ein richtiger Soldat geworden. Ein Denker, hatten manche Kameraden spöttisch gemeint, ein Träumer, und dabei doch immer das Gefühl gehabt, dass die Beschreibung nicht traf. Er war nicht versponnen und nicht verträumt. Er war anders. Er konnte befehlen, tat es aber nur selten. Er konnte manchmal überraschend mutig sein, aber er war nie kühn wie die Kameraden. Er war in all den Jahren kein richtiger Soldat geworden.
Manches hatte ihm gefallen. Die Herbstmanöver. Wenn der Himmel über den Feldern hoch und blau war und es nach Rauch vom Kartoffelkraut roch und in den Wäldern nach Kastanien. Auch die frostigen Wintermorgen, an denen der Atem der Pferde und Reiter dampfte, das gefrorene Gras unter den Hufen knisterte und die Sonne so rot aufging wie im Sommer nie. Und in der Kaserne die Stunden, in denen Strategie gegeben wurde. Er mochte das Spiel mit Möglichkeiten, die Präzision, mit der eins aus dem anderen folgte und mit der sich alles berechnen ließ. Strategie war klar und genau, aber nur ein Spiel. Er war froh, dass es in diesen Jahren keinen großen Krieg gegeben hatte, auch wenn er das nie zu den Kameraden gesagt hätte. Er hatte sich nicht nach dem Abenteuer Krieg gesehnt, weil er zu viel Fantasie hatte, die ihm ungewollt ausmalte, wie sich eine Kugel anfühlen musste, wenn sie einschlug, oder ein Bajonett, wenn es traf. Ein Schönwettersoldat eben.
Diese zehn Jahre Dienst waren eigentlich nur wie eine Fortsetzung der Schule gewesen. Es hatte große und kleine Regeln gegeben, Unangenehmes und Angenehmes und hinter allem immer einen Hauch Gemütlichkeit, der durch die Gewohnheit entstand. Ein Abschnitt, der eben zu durchleben war.
Aber jetzt, wurde ihm mit einer kleinen Überraschung klar, jetzt war er das erste Mal seit seiner Kindheit ganz und gar frei. Ein langer, leerer Sommer lag vor ihm. Ohne Pflichten und ohne Verbindlichkeiten. Er war sein eigener Herr. Er war frei. Es war ein Schülerglück, das ihn erfüllte, während er durch den grauen Morgen in die Stadt hineinging, und er hätte bei jedem Schritt lachen können, unbeschwert und einfach so, weil es schön war, alles hinter sich und nichts vor sich zu haben.
Es regnete jetzt tatsächlich, aber das machte nichts. Wenn es das tat, roch alles nur noch stärker, und August liebte die Gerüche. Wenn er die Augen schloss, konnte er sie sogar sehen. Jeder Duft hatte eine Farbe, für die es in der Sprache keine Wörter gab. Auch der Geruch von Frühlingsregen, er war wie ein blasses, unaufdringlich heiteres Lindgrün. Um ihn herum hasteten die Damen und Herren die Straße entlang, und es war ein Spaß, ganz unberührt und gelassen und vergnügt durch den Regen zu gehen. Heute konnte er nicht nass werden. Alle anderen schon, aber er nicht. Als er um die Hofburg herum war, zögerte er einen kleinen Augenblick und überlegte, wohin er sich wenden sollte. Dann sah er die Schaufenster der Konditorei Demel, ging quer über die Straße und trat ein. Er ging gern ins Kaffeehaus, weil er die Düfte dort liebte. Wie er die Gerüche draußen liebte, so liebte er auch die Aromen im Demel, die in Schleiern in der Luft lagen, sich gemächlich umeinander drehten und alle zusammen die Atmosphäre des Kaffeehauses ausmachten. Als Erstes und am stärksten kam einem, wie als Begrüßung, schon an der Tür der Geruch des frisch röstenden und aufgebrühten Kaffees entgegen. Dann der Zigarrenrauch, der einzige Duft, den man sehen konnte. Und dann, ganz zart und jeder unverwechselbar, die vielen kleinen Düfte. Bitter, von geraspelter Schokolade. Oder geschmolzen und süß, von den Schokoladen der Damen an kühlen Tagen wie heute, mit einem Hauch Vanille darin. Tragant, der einfache, süße Geruch, der von all den Zuckerfiguren ausging. Honig. Überall, wieder wie Farben, die unterschiedlichen Gerüche des Honigs: rosigsüß im Rachat-Lougoum, blütensüß im Halwa, walddunkel in den Nonnenkrapferln, durchsichtig fein im Akazienblütenkonfekt. Wunderbar und gefährlich schön der Bittermandelgeruch vom Rehrücken, dieser langen, glänzend schokolierten Torte. Einen Geruch gab es, den erkannte August nicht gleich. Er blieb einen Augenblick stehen und sah sich um, bis er entdeckte, woher er kam. Ja. Das war der schwache, aber unverkennbare Heimatgeruch von warmer Milch, bevor sie in den Kaffee gegossen wurde. Und alles zusammen mischte sich zum Duft von Freiheit, denn wenn man im Kaffeehaus war, war man ja dort, weil man sich freigemacht hatte. Alles andere blieb außen vor. August setzte sich nahe den Fenstern, bestellte und trank den starken Kaffee unter dem kühlen Schlagobers. Er hatte eine Zeitung unberührt auf dem Tisch liegen und sah hinaus. Er war glücklich, und weil er wusste, dass Glück nie lange dauerte, bewegte er sich sehr behutsam, um es nicht vorschnell zu verjagen.
Vor den Fenstern blieben die Leute stehen. Ein kleiner Auflauf entstand. August sah neugierig hinaus. Die Leute standen mit dem Rücken zu ihm und blickten auf die Gasse. Durch sie hindurch konnte er sehen, wie auf einmal ein sehr großes Rad erschien, an ihnen vorbeifuhr, langsamer wurde und – für August außer Sicht – verschwand. Ein Hochrad. Er musste lächeln. Bisher hatte er immer nur Bilder davon gesehen. Als er gegen seine Neugier entschied, einfach sitzen zu bleiben, ging die Tür auf, und er sah das Rad an die Wand gelehnt stehen. Eine junge Frau mit einem sehr großen Hut trat ein; sie achtete nicht auf die milde Empörung, die sie in der kleinen Menge ausgelöst hatte, die noch immer vor dem Demel stand und Rad und Fahrerin begaffte. August sah ihr zu, wie sie sich setzte, ohne sich vom Ober einen Tisch zuweisen zu lassen. Seine Kameraden hatten sich manchmal über ihn lustig gemacht, weil er gerne im Demel war. Ein Kaffeehaus, in dem Frauen verkehren, hatten sie in gutmütigem Spott gegrinst, das schaut nach dem Liebeskind aus, nicht wahr?
August beobachtete die Frau und dann die Gäste – alle sahen zu ihr hinüber, bis auf den alten Herrn, der nur aus seinem Intelligenzblatt auftauchte, um pünktlich alle Stunde eine weitere Schale Kaffee zu bestellen – und war hin- und hergerissen zwischen dem Ärger über den Hochmut, mit dem sie hereingekommen war, und der Bewunderung für ihren Mut.
»Mazagran, bitte!«, bestellte sie schließlich, und das war wirklich maßlos arrogant. Mazagran war kalter Mokka mit Cognac. Man trank keinen Mazagran am Vormittag. Auf einmal ärgerte sich August doch. Über sich und über die Hochradfahrerin. Sein Glück von vorhin war verflogen, er hatte sich von ihr und seiner Neugier zurück in die Welt ziehen lassen. Und weil ihn ihr Hochmut reizte, sagte er wie nebenbei und nicht einmal bewusst an sie gerichtet:
»Ich dachte, in Wien sei das Hochradfahren verboten.«
Sie sah auf und ihn kühl an. Sie hob nicht einmal die Brauen. Plötzlich fühlte August sich dumm, aber gleichzeitig kam ihr Duft bei ihm an, ein Duft wie von fremden Gewürzen, farbig und voll, doch hinter diesem Parfum lag noch etwas Bitterschönes wie glimmendes Heu; ein Duft, den er sofort mochte, obwohl er die Frau nicht leiden konnte.
»Liegt das daran, dass die Wiener beim Hochradfahren zu oft stürzen, Herr Leutnant?«, fragte sie mit klarer und lauter Stimme, und ein paar Köpfe drehten sich zu ihr und ihm um. Sie hielt seinen Blick fest. August, der sonst im Gespräch nicht langsam war, fiel nicht sofort das Richtige ein.
»Sie sind keine Wienerin, nicht wahr?«, fragte er, aber was scharf klingen sollte, hörte sich nur stumpf an.
»Nein«, sagte sie und ließ seinen Blick immer noch nicht los, als sie mit Vorbedacht und effekthascherisch anfügte, »zum Glück nicht.«
An einem der anderen Tische murrte es in halbherziger Empörung. August konnte nichts sagen, obwohl er ihr gerne irgendwie über den Mund gefahren wäre. Aber ihm fiel einfach nichts ein. Immerhin hielt er ihren Blick aus, bis sie beide, fast gleichzeitig, den Kopf drehten. Er faltete die Zeitung auf, und sie trank ihren Mazagran. Die Gespräche an den anderen Tischen wurden wieder aufgenommen, die Kaffeemaschine summte, und aus der Küche hörte man gedämpft, wie der Lehrbub Obers aufschlug.
»Zahlen!«, rief August nach zehn Minuten, als es sich nicht mehr nach Rückzug oder Niederlage anhörte, beglich die Rechnung und ging an ihrem Tisch vorbei, ohne dass sie noch einmal herschaute oder er zu ihr. Als er aus der Tür trat, sah er das Hochrad noch immer an der Wand stehen, und er fragte sich unwillkürlich, wie sie ohne...