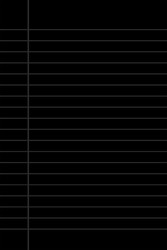Suchen und Finden
Service
Tausend Tode schreiben
Christiane Frohmann
Verlag Frohmann Verlag, 2015
ISBN 9783944195551 , 775 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz frei
21
Noch zwei Jahre, hatten sie gesagt. Eher weniger, hatten sie gesagt. Perfide präzise kommt der Tod nun, hält sich an jede Statistik, ist höflich und pünktlich. Schickt ein paar Metastasen vorbei, die Bescheid geben, dass sie jetzt bitte ihre Koffer packen möge: Die letzte Reise beginnt in Kürze – bitte einsteigen, die nächste Fahrt geht vorwärts.
Es ist Juni. Seit drei Wochen ist sie im Hospiz. Oder seit vier? Ich sehe in den Kalender: Es sind erst zwei Wochen. Die Zeit verfliegt, und doch dehnt sie sich. Jede Stunde mit ihr ist Freude, Staunen, Wagnis und Traurigkeit in einem einzigen Moment. Und Furcht.
Sie isst jetzt am liebsten M&Ms. An manchen Tagen sind sie das einzige, was sie isst. Aber warum nicht, wer sollte sie maßregeln, wer sollte das Recht haben, ihr noch etwas vorzuschreiben. Und wozu. Mit spitzen Fingern greift sie nach einer Nuss, legt sie sich in den Mund, zerbeißt sie. Dreimal tut sie das, vielleicht viermal. Dann ist sie satt. Dann nimmt sie ihre Schnabeltasse. Trinkt. Sie ist 57 Jahre alt. Jede Woche altert sie um ein Jahrzehnt.
Es wird Juli. Es ist heiß draußen. Jemand hat ihr die Fußnägel lackiert und einen Schmetterling auf den großen Zeh geklebt. Sie wackelt mit den Zehen, als sie es mir zeigt, und lacht. Es sieht schön aus.
Wir sollten dankbar sein, dass die Metastasen erst jetzt in ihren Kopf gekrochen sind. Es war kaum zu hoffen, dass sie so lange warten. Doch Dankbarkeit will sich nicht einstellen. Es ist vielmehr, als müsste ich bei einer Gewalttat zusehen. Ich möchte schreien: „Aufhören! Aufhören!“, damit die Täter vom Opfer ablassen, ich möchte auf sie einschlagen, sie kaputttreten, aber – nichts. Ich kann nichts weiter tun als zusehen, wie es geschieht.
Heute Abend möchte sie ein Leberwurstbrot. Das Hospiz hat Ausstechförmchen, kleine Bissen machen es den Sterbenden leichter. Heute kommt das Brot in Herzen, Leberwurstgraubrotherzchen. Sie isst mit Genuss. Dazu trinkt sie Cola, die wir andicken, denn sie kann nicht mehr gut schlucken. Ich probiere die kalte, dicke Cola, möchte wissen, was wir ihr auftischen. Sie schmeckt gut, wie angetautes Wassereis – wie damals, von der Bude.
Wovor fürchte ich mich? Ist es überhaupt Furcht, die ich empfinde? Oder ist es eher Fassungslosigkeit darüber, mit welcher Wucht der Tod kommt? Wie unbeirrt er sie aussaugt. Wie er Tag für Tag etwas von ihr mitnimmt – ihre Mimik, ihre Gestik, die Art und Weise, wie sie spricht, wie sie atmet.
Ihr Atem – er schnürt mir den Hals zu. Ich sitze neben ihr und atme gemeinsam mit ihr ein, hole Luft, tief Luft, so tief, dass ich spüre, wie meine Lungen sich weiten – auf dass sie es mir nachtut, auf dass sich ihr Brustkorb hebt und das Leben einlässt. Aber sie atmet unbeirrt im flachen, stockenden Rhythmus der Sterbenden. Immer wieder schläft sie ein. Blutiger Urin tropft in einen Beutel.
Ich sehe aus dem Fenster; es steht offen. Draußen knirschen Reifen auf Kies. Ein Windhauch wölbt die Gardine und streichelt meine Arme. Es riecht nach gemähtem Gras und Gewitterregen. Ich denke: Durch dieses Fenster wird bald ihre Seele hinausfliegen. Ich weiß nicht warum, aber ich mache ein Foto. In den Tagen, nachdem sie gegangen ist, werde ich dieses Foto oft anschauen. Als könnte ich ihr dadurch hinterherwinken.
Heute Abend gibt es Teewurst aufs Brot. Und Gurke. Kleine, ausgestochene Gurkensterne mit Salz drauf.
Tage verstreichen. Und doch bleibt die Zeit vage. Jeder Morgen, jeder Abend ein neues Befinden. Bei ihr. Bei uns. Natürlich wusste ich: Wenn die Metastasen da sind, auch wenn ich vorbereitet bin, wird es schlimm werden, werde ich hilflos sein. Aber ich bin nicht vorbereitet auf die Tiefe meiner Hilfslosigkeit, auf die Schnelligkeit, mit der ein Mensch schwinden kann, auf die Leere und Stille in meinem Innern, die gleichzeitig so prall, so allumfassend, so voll und laut ist.
Ich höre ihr zu, obwohl ich sie oft nicht verstehe. Die Metastasen, sie verwaschen ihre Sprache. Dabei möchte ich jedes ihrer Worte hören, es festhalten, in der Hand halten, keines verpassen, es verwahren, es streicheln und niemals loslassen. Doch ihre Sätze gleiten dahin, zaghaft, leise, ein Hauch – und sind fort.
Ich weine nicht viel in dieser Zeit und wenn, dann nur kurz. Ein lautloses Seufzen, zwei Tränen vor dem Einschlafen, die es kaum die Wange hinab schaffen. Mein Inneres ist grau und stumpf.
Es bleibt natürlich die Hoffnung. Dass sie friedlich gehen kann. Dass sie glücklich ist. Tröstender aber als die Hoffnung ist das Nichtwissen darüber, was sein wird. Denn wenn ich es wüsste, wäre schon jetzt all meine Kraft fort.
Es wird Wochenende. Ich komme ins Hospiz und sehe sofort den Holzengel. Holzengel an der Tür bedeutet: tot. Doch heute ist sie nur sehr müde. Es ist heiß, in der Stadt ist Kirmes. Im Zimmer nebenan ist der ältere Herr gestorben. Wir bleiben eine Weile bei ihr, dann gehen wir auf die Kirmes. Wir müssen mal raus.
Dort, direkt um die Ecke: Buden und Karussells, Lachen, Staunen und die Rufe der Schausteller:
„Steigen Sie ein! Machen Sie mit!“
„Greifen Sie zu! Lose nur fünfzig Cent!“
„Auch für Sie, junge Frau!“
Wie Wasser fließen die Geräusche um meinen Kopf. Dazu der Duft von Mandeln und Zuckeräpfeln. Ich laufe durch die Straßen ohne Anker in die Welt, betrachte die Fahrgeschäfte, die Losbuden, die Familien, die sich Poffertjes und Paradiesäpfel teilen, Kinder voller Übermut, die von allem nicht genug bekommen können. Ein paar hundert Meter die Straße runter isst ein Mensch heute Abend seine letzten Leberwurstgraubrotherzen.
Wir bringen ihr einen Delphin-Luftballon mit. Sie liebt Delphine. Wir knoten ihn an ihrem Bett fest. Er schwebt nun am Fußende. Delphine sind die besseren Holzengel.
Dann. Sie spricht leise, aber deutlich. So deutlich wie seit Wochen nicht mehr. Sie spricht lange. Zwanzig Minuten lang spricht sie, ohne zu ermüden. Ich sitze da, halte ihre Hand. Ich beruhige sie. Ich tröste sie. Ich verspreche es ihr. Alles. Zum Abschluss sagt sie: Es sei schon spät. Ich solle jetzt besser gehen. Dann sinkt ihr Oberkörper nach hinten, sie schläft augenblicklich ein. Ich schließe sanft die Tür hinter mir, setze mich ins Auto und weine zwei kleine, heiße Tränen.
Auf dem Rückweg gewittert es, der Regen klatscht in dicken Tropfen auf meine Windschutzscheibe. Bäume biegen sich mit vollen Kronen im Sturm. Es riecht nach Sommer und Leben.
Einen Tag später. Ich stehe an ihrem Bett, sie umklammert meine Hand. Fünf Wochen ist sie nun im Hospiz. Eine Schwester spritzt ihr Morphium in den Oberschenkel; eine Spritze, zusätzlich zum Methadon, zusätzlich zur üblichen Dosis. Sie drückt meine Hand zu Mus. Es tut weh, aber was sind meine Schmerzen schon gegen ihre Schmerzen, gegen diese unfassbaren Schmerzen.
Nach einer Viertelstunde entspannen sich ihre Gesichtszüge, doch ihre Hand umkrallt weiter meine. Ich vermag sie nicht herauszuziehen. In der Ferne der wogende Klang der Kirmes.
Plötzlich wendet sie den Kopf. Mit klarem Blick sieht sie mich an und entschuldigt sich, dass sie Weihnachten nicht mehr mit uns feiern wird, es tue ihr sehr leid, so wahnsinnig leid.
Am Abend. Ich habe den tiefen Wunsch, dass die Zeit stillstehen möge. Möchte jede Minute mit ihr genießen – und habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu müde, zu fahrig bin. Wenn ich nach Hause will. Wenn ich fortlaufen möchte, wenn ich schreien möchte und nicht kann.
Daheim lese ich übers Sterben. Über Herzstillstand, Hirntod, über Zersetzung. Ich lese über Eiweiße, die bei Muskelbewegung aneinander vorbeigleiten, die nach dem Tod ein Netz bilden, das die Totenstarre verursacht. Ich lese, wohin das Blut sackt, wie die Temperatur sinken wird. Ich möchte alles genau wissen.
Liege ich im Bett, sehe ich Bilder von ihr. Als Blitzlichter tauchen sie vor meinem inneren Auge auf. Wie sie auf dem Sofa sitzt. Wie sie in ihrer Küche steht. Wie sie spazieren geht. Ihre Bewegungen, der wiegende Gang. Wie sie ihre Hände hält. Wie sie ihre Enkel herzt. Ich höre sie sprechen – keine bestimmten Worte, nur den Tonfall. Ihr Lachen.
Ich sage mir: Du beginnst...