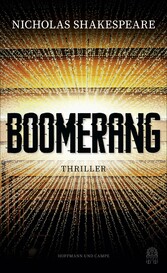Suchen und Finden
Service
Boomerang - Roman
Nicholas Shakespeare
Verlag Hoffmann und Campe, 2020
ISBN 9783455009231 , 400 Seiten
Format ePUB
Kopierschutz Wasserzeichen
2. Kapitel
Dyer war um vier Uhr an diesem erfrischend kalten Februarnachmittag stocksauer vor dem Tor der Schule eingetroffen. Seit siebzehn Monaten war er wieder in England. Seine Nachforschungen hatten in eine Sackgasse geführt. Das Wetter in Oxford, die Gespräche mit anderen Eltern bedrückten ihn.
Und jetzt war auch noch sein Sohn gemobbt worden.
Er dachte an Brasilien; die Hitze, die silberne Fläche des Ozeans, seine Jahre als Auslandskorrespondent …
Als Journalist musste man mit allen zurechtkommen, mit dem Terroristen und mit dem Polizisten, der ihn jagt. Aber diese wohlhabenden Leute aus der Mittelklasse, die bei weitem keine Idioten waren, verstand Dyer überraschenderweise nicht. Sie sprachen seine Sprache. Viele von ihnen hatten den gleichen Hintergrund und Bildungsweg wie er: Früher wären sie seine Leser gewesen. Doch ihre Ansichten über die Welt bestürzten ihn.
Seinem Sohn zuliebe hatte Dyer seinen Impuls unterdrückt, zu urteilen und zu flüchten. Dieses eine Mal versuchte er, es unkompliziert zu halten; mitzuspielen, hart zu arbeiten, ein engagierter Phoenix-Vater zu werden. Er schloss sein inneres Auge und knebelte seinen natürlichen Hang, auszusprechen, was er dachte.
Dyer sagte sich, dass er so reagierte, weil er älter und relativ spät Vater geworden war. Und er stammte aus Oxford – es hätte ihn überrascht, wenn auch nur die Hälfte der anderen Eltern einen britischen Pass besessen hätte –, das war zu »seiner Zeit«, wie er es nur ungern nannte, noch ganz anders gewesen; die andere Hälfte war zwar jünger als er, hatte aber wesentlich bessere Positionen und war wesentlich bessergestellt als er. Sie arbeiteten in London, im Fernen Osten, Asien, Afrika, für global agierende Firmen und Regierungen. Sie jetteten von den runden Ecken der Welt hierher, von Orten, von denen Dyer im Alter seines Sohnes lediglich dank seiner Briefmarkensammlung gehört hatte. Ein oder zwei hatten sogar Leibwächter.
An diesem Nachmittag war er bis um halb vier in der Taylorian Bibliothek gewesen. Bevor er sie verließ, bestellte er ein Buch über Portugals zufällige Entdeckung Brasiliens im Jahr 1500. Dann checkte er aus Gewohnheit noch die BBC-Nachrichten auf seinem Laptop.
Das große Drama des Augenblicks, das einen UN-Bericht zur Erderwärmung auf den zweiten Platz verdrängte, war eine Rede des neuen Amtsinhabers im Weißen Haus. Der amerikanische Präsident hatte es zu seiner Mission gemacht, eine nach der anderen jede Übereinkunft zu kündigen, die sein Vorgänger ausgehandelt hatte. Sein jüngstes Ziel: das über vier Jahre alte Atomabkommen mit dem Iran. Seine schrillen Anschuldigungen, dass der Iran sich nicht an die internationale Vereinbarung halte, hatte die Regierung in Teheran so verärgert, dass sie drohte, ihr Atomprogramm neu aufzulegen. Für diesen Fall versprach Israel Vergeltung zu üben, ebenso Saudi-Arabien.
Dyer spulte zurück zu dem Angebot, das ihm sein Chefredakteur zwei Jahrzehnte zuvor gemacht hatte: »Sie sind der Doyen der Lateinamerika-Korrespondenten – jeder weiß das. Aber die Buchhalter haben verfügt: Schließt Lateinamerika. Punkt. Sie können entweder Moskau haben oder den Mittleren Osten. Was soll’s sein?« Nachdem er eine Woche gezögert hatte, entschied sich Dyer weder für das eine noch das andere: Südamerika war die Quelle seiner Geschichten, die Welt, die ihm am Herzen lag.
Doch manchmal bedauert man seine Entscheidungen. In Momenten innerer Unruhe fragte sich Dyer unwillkürlich, was für ein Leben er geführt hätte. Vielleicht war es noch nicht zu spät, Leandro aus der Phoenix zu nehmen und mit ihm nach Teheran zu gehen, dachte Dyer wehmütig, als er merkte, dass er an der Bardwell Road vorbeigegangen war.
Er bog rechts in die Linton Road, wich einem Riss im Asphalt aus und ging rasch zur Schule.
An der Ecke wartete er neben einem altmodischen roten Briefkasten, bis ein großer schwarzer Lexus vom Bordstein weggefahren war. Als Junge hatte Dyer in dem Haus in seinem Rücken gewohnt, Ziegel und Gips, von der Farbe von Fieberbläschen und Wundpflaster. An wie vielen Sonntagmorgen hatte er rittlings auf diesem schiefen edwardianischen Briefkasten gesessen und darauf gewartet, dass die Singer Gazelle seiner Eltern heranrumpelte? Öfter als er zählen konnte.
Die genervt um sich blickende Mutter am Steuer des Lexus stieg aus, um ihrer Tochter mit dem Cello zu helfen. Kaum hatte sich das Auto vom Bordstein entfernt, überquerte Dyer die Straße.
Als die Zeitung das Büro in Rio schloss, war er geblieben, um sein Buch über die Kultur- und Sozialgeschichte des Amazonasbeckens fertig zu schreiben. Zu einem exorbitanten Preis von der Oxford University Press veröffentlicht, wurde es vom TLS und ein, zwei anderen anthropologischen Vierteljahresschriften wohlwollend zur Kenntnis genommen und wieder vergessen. Dyer war damit beschäftigt, Däumchen zu drehen, als seine Tante Vivien aus Lima anrief und ihn bat, eine Freundin von ihr zu besuchen, die in Rio für eine Kinderhilfsorganisation arbeitete.
Dyer konnte seiner Tante nichts abschlagen, einer einstigen Primaballerina, verheiratet mit einem pensionierten peruanischen Diplomaten, die das letzte Viertel ihres Lebens der Verbesserung der Lebensumstände von Straßenkindern in Lima gewidmet hatte. Das Ende vom Lied war, dass Dyer Viviens Freundin traf, nach einer Weile einen Job bei Ibeji annahm und in einer Favela arbeitete, die sich in einer smaragdgrünen Spalte unter den ausgebreiteten Armen der Christusstatue befand.
Er hatte Affären. Seine Tante war der Ansicht, dass er nach Astrud jemanden brauchte, der »viel runder« war. Dyer nahm seine Freundinnen mit nach Lima, damit Vivien sie bei selbst gebackenen Ingwerkeksen durchleuchten konnte. Doch Nissa stellte er ihr aus irgendeinem Grund nicht vor.
Sie hatten sich bei einer Party im »Museum von morgen« in der Guanabara-Bucht kennengelernt. Ihr verhangener Blick. Das Timbre ihrer Stimme. Nissa konnte einen Satz auf Brasilianisch beginnen und auf Französisch oder Englisch beenden und in allen drei Sprachen flirten. Zu allem bereit nahm Dyer sie mit zu sich nach Hause, als sie sich bei einer Fotoausstellung über die Sendero-Jahre erneut über den Weg gelaufen waren. Innerhalb eines Monats lebten sie in seiner Wohnung in der Nähe des Strands von Ipanema zusammen.
Fünfzehn Monate später kam Leandro auf die Welt. Nach dem, was mit Astrud passiert war, hatte Dyer sich gewappnet und geweigert, auf ein Wunder zu hoffen, bis sich zuerst ein Auge zitternd öffnete, dann das andere, und ihn zwei abgrundtiefe mitternachtsblaue Pupillen zum ersten Mal anschauten, einen schluchzenden Mann mittleren Alters.
Doch Leandros Geburt erfüllte Nissa nicht.
Wenn es sie nicht betraf, hatte Nissa eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ein Baby war ein Konkurrent. Leandro war vier, als sie Dyer für einen englischen Anwalt, Nigel Trenchpain, verließ.
Dyers Verzweiflung war transparent, farblos.
»Ich dachte, sie sei anders«, sagte er zu Vivien.
»Das ist kaum jemand, mein Lieber.«
»Oh, Vivien«, sagte er. »Oh, Vivien.«
»Ist schon okay«, sagte sie und hielt seinen Kopf. »Ist schon okay.«
Nach einem kurzen und unerwartet einfachen Gerangel bekam er das Sorgerecht für seinen Sohn.
Leandro hatte das tiefe Lachen und die Mameluckenaugen seiner Mutter, wie antikes Glas, und die beunruhigende Hartnäckigkeit seines Vaters. Nachdem er das journalistische Dilemma rasch gelöst hatte, kam Dyers starrsinniger Zug zum Einsatz, mit dem er sich seine Unabhängigkeit bewahrte. Die BBC und der Economist boten ihm Korrespondentenstellen an, doch er lehnte ab. Dyers Leben konzentrierte sich auf seinen Sohn.
Seine Tage wurden freier, als Leandro in die Vorschule ging. Während hysterische Präsidenten mit Amtsenthebungsverfahren konfrontiert waren, verbrachte Dyer seine Vormittage damit, reichen Leuten Englischunterricht zu geben, und seine Nachmittage, Klebstoff schnüffelnden Waisen das Lesen und Schreiben beizubringen.
Zu welchem Zeitpunkt dämmerte es Dyer, dass Gott zwar einst Brasilianer gewesen sein mochte – wie Dyer bei seiner Ankunft in Rio fünfundzwanzig Jahre zuvor geglaubt hatte –, inzwischen aber die Nationalität gewechselt hatte? Es war eine Anhäufung einzelner Vorfälle, nicht eine plötzliche Erkenntnis, und sie schlich sich bei ihm ein wie die Idee für sein nächstes Buch. Unter den Art-déco-Armen von Christus dem Erlöser wurde in Dyers Favela jede zweite Woche ein Straßenkind umgebracht. Drogen und Klappmesser wurden in zwei Ranzen in Leandros neuer Schule gefunden. Sogar die Strände hatten angefangen zu stinken.
Rio. Es war wahr geworden für ihn. Eine großartige Stadt – eine große Einsamkeit.
Bei einem kalten und plötzlich geschmacklosen Bier in seiner Stammkneipe in der Joaquim Nabuco überkam Dyer unerwartet das dunkle Gefühl, dass er Leandro aus Brasilien herausschaffen musste, bevor sein Sohn oder er selbst ein Messer in den Bauch bekamen. In den fünf Jahren, seitdem Nissa ihn verlassen hatte, war kein Platz mehr für Leandro in ihrem neuen Leben gewesen, deswegen war es Dyer, der handeln musste.
Zum Glück hatte Dyer für schlechte Tage etwas zurückgelegt, und davon gab es trostlos viele in Oxford. Mit dem, was von der Abfindungssumme von der Zeitung noch übrig war, einem kleinen Erbe von seinem Vater und einem größeren unerwarteten Erbe von Vivien würde er seinem Sohn die Ausbildung ermöglichen können, wie er sie selbst durchlaufen hatte.
Mit Ende fünfzig besaß Dyer keine...